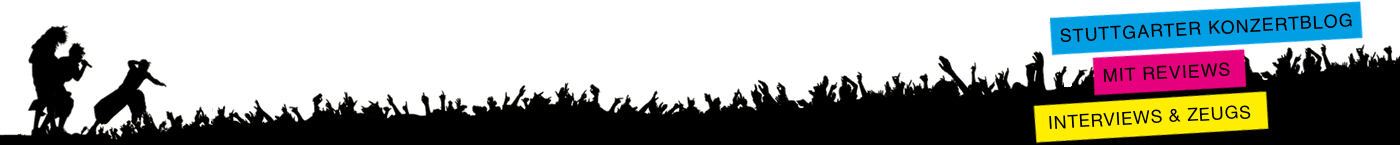MÖTLEY CRÜE, ALICE COOPER, SAINT ASONIA, 08.11.2015, Schleyerhalle, Stuttgart

Wir alle beschönigen unsere Geschichte wenn wir sie erzählen – wenn wir erzählen, wo wir gewesen sind, was wir getan haben und wer wir waren. Das ist Teil der wesentlichen psychischen Funktion, für uns zu erfinden, wer wir sind und wer wir sein wollen, um zu uns selbst zu werden. Da übersehen wir gerne, was nicht in unser Selbstbild passt. Sogar unser etwas unsteter Lebenslauf erscheint uns im Rückblick als zielgerichtete Entwicklung. Und warum sollte man auch nicht das weglassen, was nicht in unser Wunschbild passt und uns schlecht dastehen lässt? Warum nicht gelegentlich mal etwas übertreiben? Schließlich haben wir die Möglichkeit dazu, uns in besseres Licht zu rücken.
Das hat sicherlich auch Maria Augusta Trapp getan, als sie 1952 in „Vom Kloster zum Welterfolg“ ihre Lebensgeschichte niederschrieb. Definitiv beschönigt – und auch ein wenig dramatisiert – wurde ihre Geschichte dann noch mal, als Richard Rogers und Oscar Hammerstein 1959 daraus das Musical „The Sound of Music“ entwickelten. Da wurde aus der Erzieherin Maria Augusta, welche den adligen Korvettenkapitän Georg von Trapp heiratet plötzlich eine Novizin, welche dem Klosterleben entsagt, da wurde aus dem liebevollen Ehemann plötzlich ein sehr strenger – und anstelle des Hauskaplans Franz Wasner war es plötzlich Maria Augusta selbst, welche den aus Not gegründeten Familienchor leitete und unter dem Namen „Trapp Family Singers“ zu dem erwähnten Welterfolg führte.
Tja, seine Geschichte zu erzählen, hat also schon so seine Vorteile. Man kann festschreiben, wer man gewesen sein möchte und wie man erinnert werden möchte, sich vielleicht ein Mal noch selbst in die Geschichtsbücher einschreiben. So soll das wohl auch heute laufen, wenn Mötley Crüe darum bittet, dass man ihnen die letzte Ehre erweist. Zu ihrer Abschiedstour geladen hat da eine Band, die sich nicht einmal mit sich selbst einigen kann, warum sie ihre Karriere beendet: Wegen der Morbus Bechterew-Erkrankung ihres Gitarristen Mick Mars – wie es mal verlautbart, mal bestritten wird – oder weil sie sich auf dem Gipfel ihres Erfolges wähnt, wie Vince Neil sagt? Vielleicht hat der ‚zusammengewürfelte Haufen’ ja auch einfach nur endgültig voneinander die Schnauze voll? Wir werden es vermutlich nicht erfahren.
Die Selbsterdichtung ist jedenfalls in vollem Gange. Alles hier ist Inszenierung. Das fängt schon vor der Türe an, wo man uns suggerieren möchte, die Stuttgarter Station der Abschiedstournee sei ausverkauft. Ja, man versucht es da mit dem großen Gestus.

So wird Mötley Crüe eingeläutet durch „So Long, Farewell“, einem im oben erwähnten Musical „The Sound of Music“ von den Kindern des Familienchores vorgetragenen Gutenachtlied. Ja, um Abschied soll es heute gehen. Da bedient man sich gerne mal auch an den Weiten und Tiefen der Kultur. Dann geht es aber los mit „Girls Girls Girls“. Und dazu bekommen wir jedes Metal-Klischee geboten, das es jemals gab: Die Musik ist lauter als bei den vorausgehenden Bands und die Light-Show üppiger. Auch wird schon beim ersten Stück mehr Pyro abgebrannt als beim ganzen Alice Cooper-Auftritt. Und wenn ich schon dabei bin: Natürlich sind die zwei Background-Sängerinnen so knapp wie möglich bekleidet und zucken wie Go-Go-Tänzerinnen über die Bühne. Und natürlich ist die Stimme von Vince Neil ungefähr eine Oktave höher als diejenigen der beiden…
Unglaublich professionell ist das Ganze. Der Sound ist für Schleyer-Hallen-Verhältnisse gut. Die Beleuchtung lässt nicht zu wünschen übrig. Alle paar Minuten sprühen irgendwo Funken oder lodern Flammenwerfer auf. Überall blitzt und blinkt es. Und dann ist da ja auch noch die eigenwillig flache Bühne mit ihrem niedrigen Drumraiser, den stachelbesetzten Plattformen an den vorderen Bühnenkanten, zwei großen Kränen über dem Publikum und der riesigen wellenförmigen Stahlkonstruktion, welche sich über unseren Köpfen zum Mischpult erstreckt. An nichts wurde gespart. Alles ist hervorragend vorbereitet für die große Abschiedsgeste. Nur ist das halt alles nicht ganz so, wie man uns glauben machen möchte.

Tatsächlich sind Mötley Crüe gar nicht so sehr auf dem Gipfel ihres Erfolges, wie sie behaupten. Sicherlich haben sie mit 50 Millionen extrem viele Platten verkauft – aber halt auch nicht in jüngster Zeit. Der beschriene Gipfel muss dann doch eher 1989 zu „Dr. Feelgood“-Zeiten gewesen sein. Und überdies darf man vielleicht mal anmerken, dass die versammelten Mannen von Saint Asonia, die heute als erste auftreten, mit ihren Haupt- und vorherigen Bands Staind, Stuck Mojo, Three Days Grace und so weiter deutlich mehr Nr.1-Platzierungen erreicht haben als die Headliner. Auch sie legen einen sehr professionellen Auftritt hin. Auch da gibt es eine gute – doch natürlich wesentlich kleinere – Light-Show. Auch sie finden Anklang beim Publikum, selbst wenn sie nicht wirklich einen perfect match darstellen, und ich freue mich wirklich über den Staind-Song „For You“.
Aber gut. Was passiert also nun bei Mötley Crüe? Mit dem ersten Hit „Girls Girls Girls“ versuchen sie, das Publikum gleich in den Griff zu bekommen, nachdem die Begeisterung zuvor bei Alice Cooper schon überschäumte. Es gelingt nicht so ganz auf Anhieb, denn die Begeisterung ist zwar da, aber irgendwie magerer als zuvor, und sie braucht lange, bis die Band nicht mehr nur zwischen, sondern auch während der Lieder bejubelt wird. Und so folgt dann Stück auf Stück, es knallt, die Funken sprühen, die Flammenwerfer speien – einmal hat Nikki Sixx sogar einen an seinen Bass montiert – und die Mädchen rennen hin und her. Alles ist durchinszeniert. So sehr, dass es manchmal ein bisschen schal schmeckt, ein bisschen zu sehr nach Pose riecht. Die ganzen Bewegungen sind zu unspontan und beispielsweise Vince Neils Geflirte mit einer Tänzerin zu gestellt. Einmal zieht auch eine Dame blank, doch ist das eine aus den vorderen Reihen, die mit einer Großaufnahme auf den beiden Video-Wänden belohnt wird.
Dann kommen noch mehr Songs und noch mehr Feuerwerk. Und es kommt eine wohl rührend gedachte Rede von Nikki Sixx, der uns nicht nur erklärt, immer ein Messer bei sich zu tragen, sondern anhand der Geschichte, wie er als Kind immer das Messer seines Großvaters stahl, zu zeigen versucht – dann doch eine brauchbare Message – dass man nie aufhören dürfe, nach dem zu streben, was einem wichtig sei…
Dann Songs, dann Feuerwerk. Letztlich kulminieren soll wohl alles in Tommy Lees berühmtem Schlagzeug-Solo. Eingeleitet wird es durch ein pathetisches „O Fortuna“. Wieder so ein Kulturzitat. Dieses Mal vertont Carl Orff einen mittelalterlichen Text über das schwankende Schicksal. Ja, wir wissen: Es geht ums Abschiednehmen. Nun soll also Tommy Lee schlagzeugspielend in einer Art Achterbahnfahrt auf der geschwungenen Stahlkonstruktion über die Köpfe des Publikums hinweg zum Mischpult fahren und sich dabei sogar mehrmals überschlagen! Das klingt spektakulär und ist es auch ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Und das ist symptomatisch für die ganze Show.
Zwar ist klar, dass es eine echte Herausforderung darstellt, kopfüber Schlagzeug zu spielen, schließlich muss man nach oben treten und so, aber die derart gravitätisch angekündigte Riesenattraktion läuft lediglich im Schneckentempo eines Lifta-Seniorenfahrstuhles ab. Es ist halt doch nicht alles immer so toll und groß, wie man es nachher gerne in seinen Erzählungen gehabt hätte. Und dann diese Ansage, während Tommy Lee da oben über dem FOH schwebt, sein ganzes Leben lang habe er auf diesem Moment gewartet, das für uns zu machen, während er von da oben in eine halb leere Halle blicken muss – einfach weil es nichts war mit ‚ausverkauft’ und hinten einfach niemand mehr steht. Da kann Tommy Lee einem fast leid tun. Aber so ist das halt mit der großen Geste: Man muss sie und die Halle auch füllen können, sonst bleibt es eben nur eine (halb) leere Geste.

Alice Cooper hatte da keine Probleme. Auch er ein Riesenstar. Der größte eigentlich heute. Auch er mit über 50 Millionen verkauften Platten ein Megaseller. Und natürlich ist auch das alles Inszenierung. Mehr noch: Es ist Theater, in welchem die irgendeinem Albtraum entsprungene Kunstfigur Alice Tausend Tode stirbt. Da er heute nur als Vorband auftritt, sehen wir eine etwas abgespeckte Variante. Das macht dem Publikum aber nichts, rastet es doch schon aus, als er – wie eine Fledermaus in schwarze Haut gehüllt – auch nur auf die Bühne kommt. Und so bleibt das beim gesamten Auftritt: Jedes Stück wird mitgesungen, selbst als „Schools Out“ plötzlich die Lyrics von „Another Brick in the Wall Pt. 2“ hat, und die sechs Musiker werden bejubelt bis dorthinaus.
Klar ist auch das Inszenierung. Klar ist auch das Klischee. Von den seltsamen Metal-typischen Kostümen – mal Sleaze Rock-Fetzen mal Black Metal-Pelzkragen – bis zum völlig lächerlichen Oben-ohne-definition-of-a-man-Auftritt des Bassisten quasi als Groupie-Litfaßsäule. Aber Alice Cooper will auch nichts anderes sein als eine Tongue-in-cheek-Persiflage auf das Horror-Genre. Er will überzeichnen und kann das deshalb auch gefahrlos tun.
Aber bei Mötley Crüe funktioniert das halt nicht, denn denen geht es um den großen Auftritt, den Versuch ein Mal noch etwas von musikhistorischer Relevanz zu bieten, ein Mal noch zu zeigen, dass man mit den ganz Großen wie etwa Kiss mitspielen kann – um dann doch irgendwie an diesem Anspruch zu scheitern. So beginnt sich der Auftritt nach dem salto liftale dann auch mächtig zu ziehen – begonnen bei einem nur zweitklassigen Gitarren-Solo und weiter über die ganzen Stücke, die alle irgendwie gleich klingen, und noch mehr Feuerwerk und noch mehr Tänzerinnen und noch mehr von Ventilatoren aufgebauschten Haaren. Nur am Schluss dann, nachdem Nikki Sixx und Vince Neil auf den zwei Kränen über dem Publikum gekreist sind, werden zur Abwechslung mal und dann wieder und wieder Konfettikanonen abgefeuert.
Viel Pose bekommen wir also zu sehen, die aber – und das muss man mit Nachsicht und Anerkennung sagen, schließlich handelt es sich ja um Showbiz – zur Begeisterung des Publikums mit viel Elan und makellos eingenommen und gehalten wird.
Zum Grande Finale spielt Mötley Crüe dann noch eine Zugabe auf einer Mini-Bühne direkt am Mischpult. Dass das Publikum dafür dann erst nach hinten gehen muss, verzeiht es ihnen sicherlich leicht, schließlich endet der letzte Auftritt der Band so fast auf Augenhöhe und fast heimelig mit „Home Sweet Home“ und einem noch heimeligeren „My Way“ als Rausschmeißer.