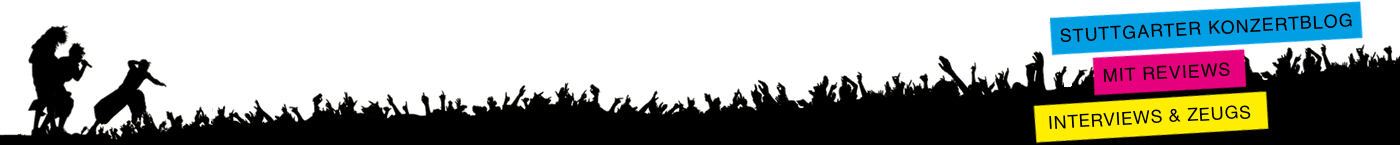HELGE SCHNEIDER, 02.03.2017, Liederhalle, Stuttgart

Als Helge Schneider die Bühne betritt, wirkt er munter. Das beruhigt diejenige Fans, die besorgt waren, weil in der vorangegangen Woche ein Auftritt in Köln krankheitsbedingt abgesagt werden musste. „Guten Tag, mein Name ist Helge Schneider und ich möchte Sie zum Lachen bringen“, sagt er zur Begrüßung unmittelbar nach seinem Erscheinen; prompt wiederholt er die Floskel. Seine Auftritte leben von Wiederholungen und so wird sein Slapstick-Gang mit dem Klavierstuhl als Gehhilfe, oder „Rollator ohne Räder“, im Laufe des Abends gleich mehrfach immer leicht variierend vorgeführt. Im weiten, schwarzen Frack, mit rotem Einstecktuch steht, nein läuft, er da wie ein langhaariger Charlie Chaplin als Tramp und wird bereits von seinem Schenkel klopfenden Publikum begrüßt. „Kommt eine Frau zum Frauenarzt“, beginnt er und bei jeder anderen Veranstaltung müsste man mit dem Schlimmsten rechnen. Helge Schneider ist aber zum Glück nicht Mario Barth und doof, wie mit Kreide auf seinen Rücken gekritzelt steht, ist heute Abend gar nichts.
Stattdessen nutzt er Kalauer als Grundlage seiner ausufernden dadaistischen Witzeleien, lässt lange auf Pointen warten, um dann einen ganz anderen Weg zu gehen. Schneider ist nicht nur ein außerordentlich begabter Jazz-Pianist, er nimmt sich auch dem, was mit dem Unwort Comedy bezeichnet wird, an, als wäre es ein Musikstück. In der bestuhlten Liederhalle erwartet die Zuschauer so eine Lehrstunde in Sachen Improvisation. Gerade erst hat ihn die Spex als „kauzige[n] Maestro des Stand-up-Klamauk“ bezeichnet, was der Sache sehr gerecht wird. Schneider plaudert und musiziert einfach wild drauf los. Zig Instrumente stehen auf der Bühne verteilt; hier ein Steinway-Flügel, da ein Cello, in der Ecke eine E-Gitarre mit Marshall-Verstärker vor einem roten Ledersessel, davor ein kleines Schlagzeug. Der 61-Jährige aus Mülheim an der Ruhr spielt sie alle.

Dazu entdeckt man zwei große Röhrenradios, passend zum Tourtitel „Radio Pollepop“. Schneider schreitet zum Radio auf der rechten Seite, schaltet es an. Es läuft für wenige Sekunden ein Ausschnitt aus einem Pur-Schlager. Ja, Schneider weiß, wo er ist, und wie man die Zuschauer begeistert. Er verzieht das Gesicht und schaltet das Gerät prompt wieder ab. Der Tourtitel passt. Er sei froh in Stuttgart zu sein, in der Liederhalle. Mit gespielt angestrengter Miene blickt er auf seine Handfläche, als sei sie eine Moderationskarte. „Schön hier zu sein. Stuttgart ist ja auch nicht so groß, das mag ich, also im Vergleich zu Rio de Janeiro ist es sogar ziemlich klein“. Lachen. Schneider sitzt am Cello, spielt etwas, plaudert im unnachahmlichen Schneider-Sprech über das Instrument, bricht die Erwartungen, indem er es wie eine Querflöte an den Mund hält, dann erfüllt er sie mit seiner typischen Udo-Lindenberg-Parodie wieder auf ganzer Linie: „Sie spielte Cello“. Sein Blick wandert hinüber zum Flügel. „Der ist offen, falls ich mal muss, versteht ihr?“
So glatt rasiert wie heute sah man Helge Schneider selten und es lässt einen der Eindruck nicht los, er könne auch als Jürgen Drews-Imitator durchgehen. Glücklicherweise sind Schneiders jazzige Nonsense-Evergreens wie „Katzenklo“ oder „Käsebrot“ aber meilenweit vom Schlager entfernt, und werden beide in ausufernden Improvisation zu erstaunlich überraschenden Highlights des Abends.

Natürlich sind das Standards, auf die das Publikum sehnsüchtig wartet und die dann zu purem Jazz verwandelt werden. Der „Meisenmann“ mit der dazugehörigen pantomimischen Darbietung von Sergej Gleithmann ist längst ein Klassiker der absurden Unterhaltung. „I’m only human after all“ singt Schneider dann einen aktuellen Radiohit, als wäre es eine Grönemeyer-Nummer. „Ich liebe ja Radio, hör ich immer“. Später trommelt er dann ein wenig, „das ist ’ne Bongo, die ist aus der Bongolei“, Gelächter und die verdiente Pause folgen.
Umgezogen kehrt er nun in einem anderen Anzug zurück. Auf der Rückseite steht diesmal intelligent geschrieben, was sich durch die zusätzliche Musikalität der zweiten Hälfte zu äußern scheint. Mal spielt er mit viel Kunstnebel einen Blues à la B.B. King, singt dabei über seine Momma und seinen Poppa, und dass diese seine parents seien. Ja, ja. „Blues geht immer“, ruft er und kichert. Das wird auch beim Schlagzeug-Duell mit der englischen Drummer-Legende Pete York weiter bewiesen, der einst mit Clapton und anderen Größen spielte. Seit einigen Jahren gehört er zum Stammpersonal jeder Schneider-Tour. Gerade hat man eine gemeinsame Jazz-Platte aufgenommen, auf die mit dem Zwischenspiel nett hingewiesen wird. Dann setzt sich Schneider wieder an die Hammond-Orgel und gibt York Raum für ein infernalisches Solo, während er selbst Be-Bop-Rhytmen singt.
Es folgen weitere Kostproben Schneider’scher Brillanz, einige köstliche Parodien und auch mal ein Seitenhieb gegen Donald Trump, der ebenso wie seine Dekonstruktion der deutschen Nationalhymne am Cello als gelungene Abrechnung mit rechtspopulistischen Strömungen verstanden werden kann.
Mit „Es gibt Reis“ auf Zuruf gibt es noch einen Klassiker zum Schluss, der garniert mit einem abgewandelten „Georgia, on my mind“-Finale und auf den Veranstaltungsort gemünzten Versen, besticht – Achtung schlechtes Wortspiel – ohne zu bestechen: „Stuttgart, oh Stuttgart, oh my Degerloch. Ich habe Hunger, ich geh‘ nach Esslingen. Feuerbach, Vorsicht! Stuttgart, du schönste Stadt der Welt.“ Das Publikum lacht und ist glücklich. Schneider hat wieder einmal gezeigt, dass er über ein komödiantisches und musikalisches Talent verfügt, das hierzulande und vermutlich weltweit völlig einzigartig ist. Das fügt sich in das Bild, das er jüngst in der Spex von sich gezeichnet hat: „Das Wort Talent trifft es“, erklärte er, „[m]ehr als Talent habe ich aber auch nicht. Ich habe Talent, bin aber faul und könnte viel besser spielen, wenn ich mich irgendwann einmal wirklich hingesetzt und geübt hätte.“ Dass das unnötig ist, liegt auf der Hand. Denn es ist schlicht unmöglich, Schneider nachzuahmen. Es wird einem immerzu auf’s Neue bewusst: Schneiders Kunst kann man nicht üben.