JAMIE CULLUM, DR. JOHN, 20.07.2014, Jazz Open, Schlossplatz, Stuttgart

You don’t know, how lucky I am to meet one of my greatest heroes, Dr. John, today.
Jamie Cullum strahlt. Der 34-jährige Engländer, der mit frenetischem Applaus und tosendem Lärm wie ein Popstar erster Güte begrüßt wird, zeigt fast demütiges Understatement, als es um die Legende aus New Orleans geht, die vor ihm auftrat. Im Plauderton fährt Cullum fort und erklärt, dass das erste Stück, das er sich mit elf Jahren selbst auf dem Klavier beibrachte, ausgerechnet aus dessen Feder stammte.
Ungewohnt muss das einer etablierten Figur des internationalen Popzirkus vorkommen, direkt nach einem großen Vorbild aufzutreten. Dass der Night Tripper zuvor eine begeisternde Voodoo-Messe zwischen Funk, Blues, Boogie, Jazz und Rock feiert, verstärkt den Eindruck einer verkehrten Welt, in der die einstigen Popvisionäre in den Schatten von Wiedergängern treten.
Es ist schwül, drückende Temperaturen um die 30 Grad, als seine Begleitband, The Nite Trippers, kurz vor 18 Uhr die Bühne betreten. Aufgrund massiver Unwetterwarnungen wurde der Konzertbeginn um eine Stunde vorverlegt. Dennoch werden ausgeteilte Regencapes dankbar angenommen und Schirme aufgespannt. „Das ist kein Unwetter, das ist nur Regen“, beschwichtigt die SWR1-Moderatorin, die durch das Festival führt, aber irgendwie passt das zu Dr. John und seiner Heimat.

„Does anybody need a doctor“, ruft seine Posaunistin und Musical Director Sarah Morrow den gut 5.000 Zuschauern zu, während die grandiose Band mit klassischer Rockbandinstrumentierung aus Gitarre, Bass, Schlagzeug und Orgel einsetzt und mit dem Intro die rhetorische Frage gleich beantwortet. „I want a doctor“, singen sie. Derweil schlurft John Rebennack Jr., auf krückenartige Stöcke gestützt, auf die Bühne. Sein Alter Ego, nach einem großen Voodoo-Meister Dr. John benannt, lässt darauf schließen, dass auch diese mit Federn, Hörnern, Schmuck und anderen New-Orleans-Voodoo-Standards bestückten Stöcke keine Krücken, sondern Insignien eines solchen Voodoo-Meisters sind, wie mir unser Fotograf gerne erklärt. Überhaupt sind die klassischen Symbole des Voodoo omnipräsent, zu erkennen in Dr. Johns Schmuck, am mit Sternen bestickten violetten Samt oder ganz besonders deutlich am Totenschädel auf seinem Flügel. Mit Sonnenbrille, Hut und bräunlichen Anzug scheint er trotz des schwerfälligen Gangs zu schweben, streckt die Arme mit gespreizten Fingern zum Gruß aus, nimmt am Flügel Platz, schüttelt noch einmal den langen, geflochtenen Zopf, dann geht es los.

Während die Temperaturen zusehends sinken, wird der Geist New Orleans beschworen. Das locker leicht daherkommende „Iko, Iko“, ein Stück, das wie wenige andere die Tradition der Musikmetropole der Südstaaten verkörpert, ist ein blendender Einstand. Der Musiker, der in seiner Karriere mit sämtlichen Größen der Rockgeschichte kollaborierte, ohne dass es zum Superstar des Mainstream reichte, weiß wie man in einem kurzen Set brilliert. Wo er anderenorts mit experimentellen und sperrigen Stücken begeistern könnte, geht er hier auf Nummer sicher und spielt seine Klassiker. Das Boogie-Piano harmoniert mit dem tiefen Südstaaten-Slang des Musikers. „I´m a runner in the jungle“. Jazzig geht es weiter, beiläufig zeigt er welch‘ hervorragender Pianist in ihm steckt. Langsam wippt er vor und zurück, ein Ohrring schwingt im Takt. Selbst wenn seine Bühnen-Outfits weit weniger exzentrisch als in früheren Jahrzehnten ausfallen, ist er noch heute ein Inbegriff von Charisma. Songs werden gelebt, der Mann, der seit über 50 Jahren Musik macht, wird eins mit der Musik. Zunehmend dem Wahnsinn verfallend durchleidet er in „Revolution“ von seinem alterweisen, aktuellen Studioalbum „Locked Down“ einen dystopischen Albtraum gefüllt mit apokalyptischen Bildern:
„Angels surrender, killed in their tracks / Babies, women raped / Leaders on their backs / Religious delusions / Stoned confusions / Prepare your revolution / Is this the final solution?“
Dazu dröhnt Sarah Morrows Posaune bedrohlich, setzt immer wieder zu markanten Soli an. Im darauffolgenden „Big Shot“ kann sie besonders glänzen, während Bobby Floyd an der Orgel, Gitarrist Dave Yoke, Bassist Dwight Bailey sowie Drummer Reggie Jackson ihre Arbeit durchweg mit großem Ethos erfüllen.
Foto: Michael HaußmannIn der Beurteilung des Gesamtkatalogs Dr. Johns war die Musikkritik immer überschwänglich, doch in ihrem Lob nie so einig wie beim 1968er Debüt-Album „Gris, Gris“. Benannt nach den bekannten Voodoo-Objekten, ließ Dr. John hier diabolische Rhythmen pulsieren, verband Jazz mit Psychedelic Rock und führte afro-karibische Einflüsse stilbildend in die Popmusik ein. Dagegen klingt „Sympathy for the Devil“ wie ein beschwingtes Kinderlied. Aus all dem sticht vor allem ein Song heraus: „I Walk On Guilded Splinters“, quasi das Signature Tune des Voodoo-Doctors. Über zehn Minuten zelebriert er eine verjazzte, entschleunigte Version eines der fantastischsten Rocksongs überhaupt. Wie ein Totenmarsch überkommt es den Schlossplatz, während der Regen stärker wird. Was derweil an Saxophon, Bass, Gitarre und Posaune geschieht, ist wahnsinnig präzise. Dr. John stellt sich hinter den Flügel, sorgt für zusätzliche perkussive Elemente. Das was gerade auf der Bühne passiert, ist ein seltener Moment musikalischer Perfektion, die jegliche Genre-Grenzen einreißt. Direkt gelingt der Übergang in das bekannte „Right Place, Wrong Time“ vom gleichnamigen 73er Album. Am Ende des funkigen Songs hört es auf zu regnen, Boogie-Pianos übernehmen. Beiläufig wird währenddessen die Band nuschelnd vorgestellt, es sind die einzigen Worte, die Dr. John ans Publikum richtet. Den Zuschauern kann das vollkommen egal sein. Es braucht keiner Interaktion, wenn die Performance über jeden Zweifel erhaben ist. Für den Klassiker „Let The Good Times Roll“ spielt er schließlich sogar E-Gitarre, lässt sich zu bluesigen Soli herab, schlurft am Ende noch einmal zum Flügel zurück, spielt „Such A Night“. Die Bühne verlässt er, während die Band noch spielt. Auf seine Stöcke gestützt, scheint er wieder zu schweben. Dann lächelt er, Sarah Morrow stellt erneut die Musiker vor, diesmal so, dass es jeder verstehen kann. Ein großes Konzert endet mit Sonnenstrahlen.
Foto: Michael HaußmannDass es für ihn schwer werden würde, an diese Klasse heranzukommen, musste Jamie Cullum bewusst sein, ebenso allerdings auch die Tatsache, dass ein Gros der Zuschauer nur seinetwegen anwesend ist, so dass es nicht sonderlich schwer werden würde zu überzeugen. Nach einer kurzen Umbaupause, in der auch die Flügel der beiden heutigen Protagonisten ausgetauscht werden, erscheint der junge Engländer seinen Fans. Der Applaus ist ohrenbetäubend, als Cullum hinter einer Trommel steht, „The Same Thing“ singt, und sich seine ausgezeichnete Band eingroovt. Wo Dr. Johns natürliche Autorität und Präsenz an erster Stelle standen, rückt bei Jamie Cullum die Animation in den Vordergrund.
Foto: Michael HaußmannDer 34-Jährige aus Essex ist ein glänzender Entertainer, der den schüchternen Gestus eines Jazzpianisten zugunsten einer Popstar-Haltung eintauschte. Schon beim zweiten Song klettert er auf das Instrument seiner Wahl, verkörpert Jerry Lee Lewis, Billie Joel und Robbie Wiliams in Personalunion. Die Texte sind durchsetzt von Teenager-Philosophie und -Poesie und so leicht bekömmlich wie die Musik. Europaweit ist er damit ultraerfolgreich. Am Vortag trat er vor 20.000 Fans in Turku, Finnland, auf. „She’s like a melody I tried to forget“, schmachtet er ins Publikum und hat es sogleich um den Finger gewickelt. Locker spannt Jamie Cullum den Bogen von ironiefreiem Ernst hin zu spielerischer Leichtigkeit. Alles klatscht im Rhythmus und singt Refrains mit. Während die Zuschauer Cullum vor allem für bombastischen Jazz-Pop im Stadionrockgewand feiern, sind es die ruhigen Momente, in denen er wirklich glänzen kann. Denn hinter all den großen Gesten ist es am Ende doch der klassische Jazzpianist in ihm, der gelobt werden und zur Geltung kommen will. Wenn man der perfekt durchdachten Show etwas vorwerfen will, dann dass sie zu sprunghaft ist. So croont Cullum an einer Stelle wie Frank Sinatra, nur um dann wieder Coldplay-Pomp aufzufahren. Ein bisschen scheint es ihm da wie einem anderen Jazzpianisten zu gehen, der für sein komödiantisches Talent die größeren Lorbeeren erntet, nämlich Helge Schneider. Cullum kann ausgezeichnet spielen und hervorragend singen, und dass man mit Extraversion ein größeres Publikum anspricht als mit zurückhaltenden Auftritten, steht außer Frage. So muss man den Engländer für sein Gespür für den Zeitgeist achten und ihm zugutehalten, dass er trotz ähnlicher Zielgruppe nie Gefahr läuft, zum zweiten Michael Bublé zu mutieren. Vielmehr ergeht es ihm wie der Ravi Shankar Tochter Norah Jones, die wundervoll jazzigen Soul-Pop spielt und sich immer mit dem Vorwurf des Milchkaffee-Jazz‘ konfrontiert sieht. Sicher funktioniert ihre wie auch die Musik Cullums in jedem Starbucks der Welt, doch spricht das eher für die Leichtigkeit der Songs, die den Konsens zu treffen scheinen.
Foto: Michael HaußmannZwischen eigenen Stücken werden immer wieder Songs anderer Künstler gespielt. Mal sind das naheliegende Genre-Standards von Cole Porter, manchmal aber auch Überraschungen wie Hendrix‘ „The Wind Cries Mary“. Luftküsse mit Damen im Publikum werden ausgetauscht, Cullum steigt in den Fotograben und fotografiert sich mit Zuschauern. Die sind ganz aus dem Häuschen ob so viel Nähe und feiern ihn gleich noch mehr. Klatschreflexe werden ausgelöst und als er sich dann an das Covern allbekannter Popsongs der letzten Jahre macht, ist die Begeisterung nicht mehr zu steigern. Nelly und Rihanna sind offenbar so populär, dass ihre Songs die großen Crowdpleaser sind. Und zugegebenermaßen ist gerade seine verjazzte „Don’t Stop The Music“ Fassung wirklich außergewöhnlich gut. Dass er heute ausgerechnet dieses Stück nutzt, um seine Qualität als Pianist mit Improvisationen herauszustellen, passt zur Inszenierung. Die ist so stringent, wie erfolgreich und als er sich mit einem Louis Armstrong Klassiker vor der Heimatstadt Dr. Johns verneigt und danach „High and Dry“ spielt, hat er auch mich überzeugt. Als er vor zwölf Jahren den Radiohead-Song für sein zweites Album reduziert und mit zarter Eleganz neu aufnahm, sorgte er für allerlei Aufruhr in der Indie-Pop-Szene. Wie Ryan Adams, der „Wonderwall“ zu Noel Gallaghers Freude wiederbelebte, frischte er einen totgehörten Meilensteins des Britpops auf und führte uns allen vor Augen, wie gut gerade die gefälligen Songs unserer Lieblingsbands klingen, wenn man sich ihnen erneut annimmt. Im Hintergrund zucken Blitze über den Himmel, es beginnt erneut zu regnen, als das Reduzierte vom Schwulst abgelöst wird. Die Band setzt ein und klingt erneut wie Coldplay. Für zwei Zugaben kehrt Cullum zurück. „Singin‘ in the Rain“ und Rihannas „Umbrella“ verschmelzen, riesige Regentropfen prasseln herab, Cullum stellt sich solidarisch in den vorderen Bühnenbereich. Nach zwei Stunden ist die große Gala zu Ende. Den meisten Besuchern wird Cullums Entertainment im Gedächtnis bleiben, mir hingegen die große Klasse des Voodoo-Meisters aus New Orleans und vielleicht auch ein stückweit das sympathische Understatements Cullums. Geschmack hat er ja, zugegeben.
It’s such a perfect setting. I would be here anyway to watch Dr. John.
Foto: Michael HaußmannDr. John
Jamie Cullum
Junior
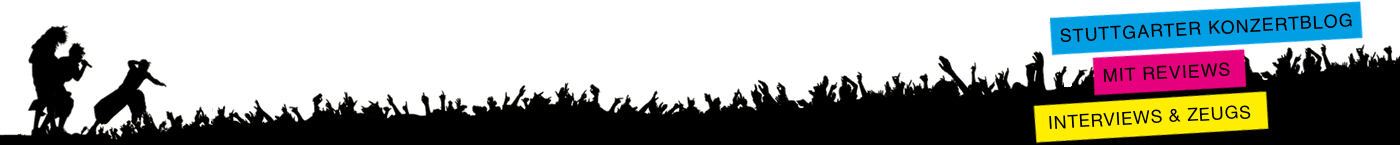
























































Große Klasse, Jens, wie du den weiten Bogen spannst und beiden Musikern gerecht wirst. Respekt!