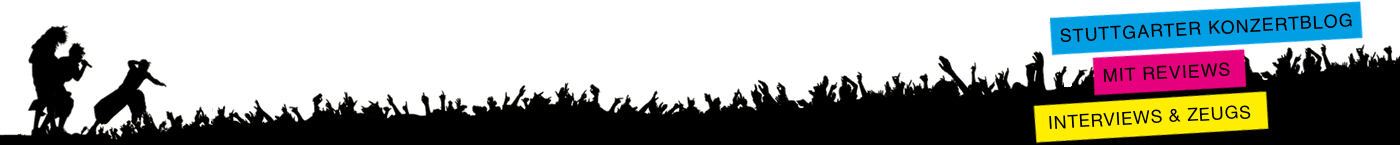THE SISTERS OF MERCY, 13.10.2019, LKA, Stuttgart

Das Geheimnis für ein befriedigendes Konzerterlebnis? Die Erwartungen auf Null herunterschrauben. Kollege Carstens Besprechung des letzten Gigs von The Sisters of Mercy war derart vernichtend, dass ich mich fragen lassen muss, warum ich mir das überhaupt antue. Nun ja, auch mir hat diese Band einen beachtlichen Anteil des Soundtracks meiner Jugend geliefert. Und ich habe sie noch nie live gesehen. Vielleicht hatten die Sisters 2017 ja nur einen schlechten Tag. Das LKA ist jedenfalls ausverkauft, es gibt also immer noch genug Fans, die Andrew Eldritch sehen wollen. Und zwar nur ihn.

Was die Londonerin A.A. Williams, die den undankbaren Support-Job übernehmen musste, leidvoll erfahren muss. Ihr gesamter Auftritt wird derart laut zugetratscht, dass er auf unserer Höhe etwa in der Mitte des Saals nur noch zu erahnen ist. Schade, ihre melancholischen Balladen können hier daheim aus der Konserve durchaus überzeugen. Ein intimeres Clubkonzert oder ein Auftritt im Mannheimer Parcours d’Amour würde vermutlich ein Erfolg.

Um Viertel nach neun entern Eldritch und seine Mannen endlich die Bühne. Die Beleuchtung ist spektakulär und der Frontmann spielt – zur Freude der Fotografen – virtuos damit. Immer wieder stellt er sich in den Kreuzungspunkt zweier Spots oder lässt ein Streiflicht auf sein Gesicht fallen. Da bekommt sein Markenzeichen, die Sonnenbrille, einen wirklichen Sinn. Und zu meiner Überraschung ist der Sound auch nicht so verheerend wie erwartet. Bass und Schlagzeug, die seit jeher aus der Retorte kommen, sind mächtig. Die Gitarren ebenfalls. Nur der Gesang ist zu schwach und undeutlich, geht in dem Spektakel unter. Wenn die Background-Vocals dazukommen, übertönen sie den Sänger. Bei jedem Song benötige ich einige Zeit, ihn überhaupt zu erkennen.

Mit neuen Songs muss man sich bekannterweise nicht auseinandersetzen, da Eldritch mit seiner kreativen Phase bereits vor Jahrzehnten abgeschlossen hat. Das ist aber kein Problem, werden doch auf Retro-Veranstaltungen wie dieser ohnehin nur die alten Hits erwartet. Und von denen hat er wahrlich genug. Nun hat das Werk ja eine gewisse Homogenität, aber dennoch kommen die Songs live so gleichförmig über die Rampe, dass ich solche Klassiker wie „Alice“ gar nicht erkenne und erst hinterher in der Setlist finde. Und ein Gänsehauttitel wie „Marian“ mangels Stimmvolumen einfach mal gar nichts auslöst. Nur bei „Something Fast“ ändert sich mal die Klangfarbe ein wenig, als einer der Gitarristen die Akustik-Gitarre auspackt. Aber auch hier kann Eldritchs Stimme nicht annähernd das Timbre und die Tiefe der Studio-Aufnahme erreichen.

Und so nimmt das Konzert seinen erwarteten, recht gleichförmigen Verlauf. Die wirklichen Klopper werden für die Zugabe aufgespart und mit „Lucretia My Reflection“, „Vision Thing“ und „Temple of Love“ kommen exakt die Titel, zu denen wir auf unseren Parties komplett auszurasten pflegten. Unter den 1.500 im LKA tut dies maximal ein Dutzend der Zuschauer. Was ich aber nicht auf den gehobenen Altersschnitt zurückführe, sondern auf die Tatsache, dass hier einfach nichts Mitreißendes geboten wird. Zum Abschied gibt es, wie zu erwarten, „This Corrosion“ und ich habe – wie zum Hohn – noch den ganzen Abend den Refrain „Hey now, hey now now, sing this corrosion to me“ im Ohr. Mit all den Erinnerungen, die diese Zeilen evozieren, hinterlässt das Konzert einen länger nachwirkenden nostalgischen Nachklang, als es eigentlich verdient hat. Es war bei weitem nicht so schlecht, wie ich erwartet hatte. Fast schlimmer: es war einfach nur knapp ok. Und damit letztlich egal.