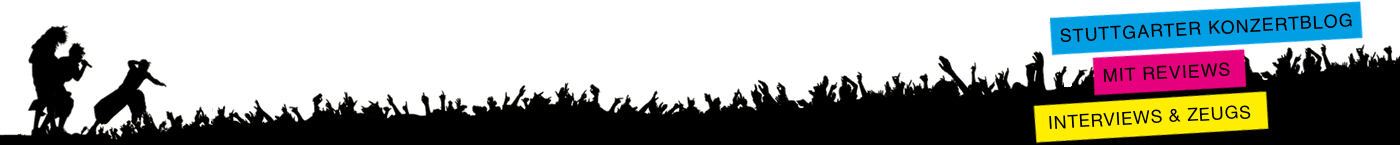GEMMA RAY, 22.09.2016, Manufaktur, Schorndorf

Ob wir denn auch Lob, Kritik oder Anregungen für die Manufaktur hätten, will der freundliche Publikums-Befrager am Eingang wissen. „Ja. Blöd, dass die Manufaktur nicht in Stuttgart ist“, witzelt der Kollege. Diese Antwort findet dann aber doch nicht den Weg in den Auswertungsbogen. Denn wir sind uns nicht ganz sicher, ob das überhaupt stimmt. Die kleine Landpartie über die B29 gehört eigentlich zum Konzerterlebnis in der „Manu“ dazu. Eine halbe Stunde Besinnung nach dem Stuttgarter Feierabends-Wahnsinn ist nicht das falscheste, wenn man sich auf ein subtiles Konzert wie das der Engländerin Gemma Ray einstimmen möchte.

„The Exodus Suite“, das formidable aktuelle Album von Gemma Ray hat uns jedenfalls in die Manufaktur gelockt. Und nicht nur uns: knapp hundert Zuschauer haben an diesem Abend den Weg hierher gefunden. Und sie erleben ein Konzert, das in einem anderen Rahmen durchaus hätte scheitern können. Was die markante Engländerin mit ihren beiden Mitmusikern zu Gehör bringt, verlangt nämlich Ruhe und Konzentration, ein Einlassen auf einen musikalischen Vortrag, der vom Sichzurücknehmen lebt.

Andi Zammit legt mit seinem reduziert gespielten und knochentrocken abgemischten Schlagzeug – zusammen mit dem schwedischen Bassisten Fredrik Kinbom – ein solides aber auch dezent-zurückhaltendes Fundament. Über diesem schwebt die mächtig verhallte Gitarre und Gemma Rays meist lakonischer Gesangsvortrag. Zugegebenermaßen dauert es einige Titel, bis sich die Faszination einstellt, dann aber mit Nachdruck. Das Publikum verharrt in geradezu erfürchtiger Stille und lässt jeden Titel bis zum letzten Ton ausklingen. „The perfect breeding ground for strange things to happen“, wie Gemma Ray angesichts der schon fast sakralen Stimmung in einer ihren knappen Ansagen bemerkt.

Das Konzert entwickelt sich immer mehr zu einem psychedelischen Soundtrack eines melancholischen Roadmovies. Vor allem, wenn Zammit Akzente an der Orgel setzt oder Kinbom (der eine frappierende Ähnlichkeit mit Karl Marx hat) zur Slideguitar greift. Und wenn Gemma nicht den britischen Akzent hätte, wäre die Illusion perfekt und man würde sich nicht wundern, wenn plötzlich Lee Hazlewood zum Duett auf die Bühne träte.
Wie gesagt: Effekthascherei gibt es hier kaum, nur einmal schrabbelt Gemma Ray mit zwei imposanten Schlachtermessern über die Gitarre oder schafft eine zweite Soundebene mittels Loop-Station. Kilbom entlockt seinem Bass, den er meist mittels einer unter die Saiten gestopften Socke maximal gedämpft hat, hin und wieder stark verzerrte Sounds, die denen eines Bass-Synthesizers ähneln.
Höhepunkte des überaus homogenen Konzerts sind für mich „Come Caldera“, der Opener des aktuellen Albums, das bluesige „Swampsnake“ vom Album „It’s a Shame about Gemma Ray“ und die „deconstructed version“ von „Shake Baby Shake“, die Gemma Ray in der ersten, aus fünf Titeln bestehenden Zugabe, solo zur Gitarre singt. Oder wie sie – ein wenig divenhaft – an einem Whisky aus dem Stielglas nippt.