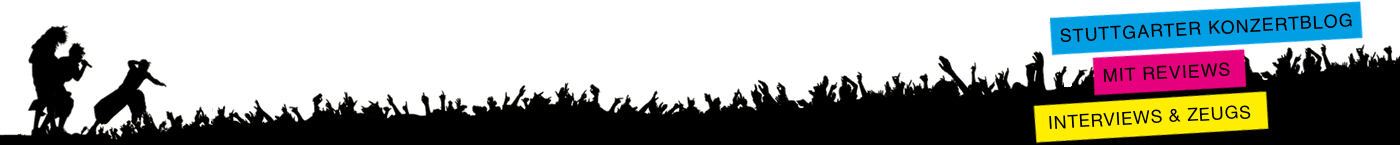HALESTORM, WILSON, 12.02.2016, Im Wizemann, Stuttgart

2009 mit dem Debüt in die US-Charts, 2010 und 2012 bereits Auftritte bei ausverkauften Rock im Park / Rock am Ring Festivals, auf Tour mit Disturbed und Papa Roach, 2013 Grammy-Award für die beste „Hard Rock/Metal Performance“? Und nun: Mit dem aktuellen Album Platz 5 in den US-Billboardcharts und in halb Europa in den Top 30. Das klingt ja nach „wir suchen den nächsten Metal-Star“. Ist das ein Hype, der nächste heiße Scheiß für den Kick, für den Augenblick? Man merkt, dass ich ob solcher scheinbar geradliniger Karrierebahnen eher skeptisch bin. Doch es ist eine schöne und befreiende Erfahrung, dass man noch offen genug ist, um sich eines Besseren belehren zu lassen und noch nicht das Stadium der allwissenden Müllhalde erreicht hat oder sich womöglich gar der Bequemlichkeit halber an den beliebten deutschen Dreisatz hält („das war schon immer so, da könnte ja jeder kommen, wo kommen wir da denn hin“).
Halestorm treten „Im Wizemann“ auf, das ich gerne noch lobend erwähne, denn eine Location für Live-Konzerte in der mittleren und auch kleinen Größenordnung fehlt schon lange in Stuttgart, insbesondere nach dem Wegfall anderer Säle (wie beispielsweise der Röhre, die S21 weichen musste). Ein Dank also an die Herren Posner, Mettmann und Wizemann sowie den zahlreichen Cro-Fans. Ich begebe mich in die Halle (also den größeren Konzertraum), die bis zu 1.300 Besucher fassen kann und in der „topmoderne Tontechnik auf roughen Industriecharme trifft“, wie ich erfahre und was auch durchaus der Wahrheit entspricht. Alles geht alles recht entspannt vonstatten, auch wenn man am Eingang ein wenig anstehen muss.

Schlag 20 Uhr kommt die Vorband auf die Bühne: Wilson aus Detroit. Fünf stattliche junge Männer, die ordentlich Testosteron-Krach machen. Drei von ihnen tragen Hipster-Bärte (ist das nicht auch endlich mal out jetzt?) und die anderen beiden, nämlich ein Gitarrist und der Schlagzeuger sind ganz im Metal-Look mit Headbanger-Mähne. Hipsterbart-Träger gibt’s übrigens auch so einige im Publikum, das im Schnitt recht jung zu sein scheint, aber in der Regel ohne Begleitung von Erziehungsberechtigten erscheinen darf.
Wilson rocken schön laut, sind auf der Bühne präsent und an ihren Instrumenten technisch versierte Könner, aber der ziemlich eingängige, stampfende Partyrock (bezeichnenderweise hießt die Homepage der Wilsons auch wilsonpartyanimals.com) ist mir doch etwas zu einheitlich. Schlagzeug und Bass drängen sich etwas sehr in den Vordergrund. Der Sänger, der auffällig oft „Stuttgart“ sagt und seines Zeichens eine rechte Rampensau ist, hat einen leichten Punk- oder Metalshout-Einschlag. Das möchte gerne dreckigen Rock’n’Roll rüber bringen, aber ganz ehrlich: Danko Jones schaffen das zu dritt aber besser. Aber das kann ja noch werden und nichtsdestotrotz sind Wilson 40 Minuten lang die perfekten Einheizer für Halestorm.

Umgebaut ist alles professionell schnell, doch unser Hauptact lässt noch extra zehn Minuten auf sich warten, bevor sie auf die Bühne kommen, dann aber ohne lange zu fackeln loslegen. Alle sehr cool – Bassist und Gitarrist in Leder- bzw. Military-Jacke, Sängerin Lzzy in Franzen-Wildlederjacke. Und zack! gibt es mal zwei richtige Knaller um die Ohren und die Frontfrau hat ihre Fans bereits um den kleinen Finger gewickelt, bevor sie diese überhaupt begrüßt und gleich mal eine Ansage zum Mitsingen macht. Und es sind wirklich Fans, denn die Begeisterung kann man nur als aufgewühlt, stürmisch, leidenschaftlich bezeichnen.
Meine Skepsis ist zwar zugegebenermaßen schon etwas weich geworden, aber noch immer nicht komplett gewichen und ich versuche mir mit Fakten zu helfen: Angefangen mit seiner Musik aufzutreten hat das Geschwisterpaar Elizabeth „Lzzy“ (Gesang, Gitarre, Klavier) und Arejay Hale (Schlagzeug) bereits 1998. Bei den ersten Auftritten war der Papa noch am Bass. Komplettiert wurde Halestorm aber erst 2003 mit Gitarrist Joe Hottinger und 2004 mit Bassist Josh Smith. Dann dauerte es allerdings noch bis 2009, bis in den USA das Debüt-Album „Halestorm“ erscheint, das umgehend in den Top 40 der US-Charts zu finden ist. Die Zeit bis zur Fertigstellung ihres ersten Longplayers nutzen Halestorm jedoch, um möglichst oft auf der Bühne zu stehen und erspielen sich so bereits einen gewissen Ruf. Eine Geschichte, die zum einen für echtes Talent und vor allem echte Begeisterung für Rock-Musik spricht.
Und was soll ich sagen?! Die Mischung aus teilweise bluesigen und poppigen Hard-Rock mit phasenweise starken Metal-Einflüssen und der wirklich beeindruckend starken Frauenstimme ist tatsächlich ganz schön mitreißend. Halestorm sind Musikprofis – allen voran die Geschwister Lzzy und Arejay – und haben ein absolutes Gespür dafür, solche Songskonstruktionen zu schreiben, die eingängig, sehr zeitgemäß, aber nicht anbiedernd oder öde sind. Und vor allem bringen sie auch die nötige Verve mit, das Ganze live authentisch umzusetzen. Auch wenn man bereits ahnt, wohin die Reise möglicherweise gehen soll: In die großen Stadien.
Trotz der vermeintlich großen Ambitionen kommt die Band absolut authentisch daher – es ist diese Leidenschaft, die man hier etwas echter und intensiver zu spüren meint, die auch alle mitreißt. Es wird sogar ein bisschen gejammt auf der Bühne. So stellt sich ein wenig das „gute-alte-Zeit“ Gefühl ein. Auch wenn nun ein paar recht abgehangene Begriffe und Klischees von mir kommen, beschreiben sie die Band aus Pennsylvania dennoch treffend: Die gut aussehende Lzzy ist eine echte Rockröhre, die darüber hinaus noch mit E-Gitarre umzugehen weiß und Klavier spielen kann. Halestorm spielen einige richtig große Songs, die das Potenzial haben, die Band einmal zu den ganz Großen gehören zu lassen.

Passend geht es auch weiter mit „Amen“ vom aktuellen Album „Into the Wild Life“:
My life
My love
My sex
My drug
My lust
My god it ain’t no sin
Can I get it?
Can I get an Amen?
Und der Saal ist nun im Halestorm Rausch, im Fieber. Lzzy weiß das nur zu gut und fragt „Can I love something too much? Because I think, I love Germany too much“ – uuuh, die Fans sind im roughen Industriecharme hin und weg und jubeln, was das Zeug hält.
Man ist auch immer zu Späßen aufgelegt und Gitarrist Hottinger hat im nächsten Song seinen Einsatz zu bringen: „Baby, ich liebe disch“. Im Liedgut des bislang drei Alben umfassenden Schaffens befinden sich durchaus auch Pink-hafte, Americana Balladen, denen man sich aber ebenso wenig entziehen kann, wie den mächtigen und energiegeladenen Rocksongs.
Nach fast einer Stunde folgt nun ein, zu meiner Freude wieder salonfähig gewordenes, Schlagzeugsolo. Und Arejay ist mir ja ohnehin schon positiv aufgefallen, da er keinen einzigen Song einfach nur mal normal spielen kann. Nein, er steht auf, heizt an, spielt im Stehen und vor allem zeigt er eine Stick-Akrobatik, bei der er seine Stöckchen dreht, schwingt, jongliert und in die Höhe wirft als wäre er eigentlich beim Zirkus angestellt. Schlussendlich zaubert er auch noch überdimensional große und somit clownhaft-grotesk wirkende Stöcke heraus, um damit sein bejubeltes Solo zu Ende zu bringen. Ich tippe auf Hyperaktivität.

Dann der aktuelle Hit „Mayhem“. Eine richtig schöne heavy-Nummer mit einem mitreißenden up-tempo Refrain. Der Song verschafft sich unmittelbar Zugang zum Blutkreislauf und übernimmt die Kontrolle über sämtliche Extremitäten. Kein Wunder, wenn man die schweißtriefende Lzzy schreien hört (und sieht):
A little mayhem never hurt anyone
Where’m I gonna get some?
A little bedlam ‚til I’m coming undone
Where’m I gonna get some?
Nach realen 60 und gefühlten 90 Minuten, kommt von Lzzy eine Ansage in Sachen Absage an das übliche Zugabe-Ritual: Wir können jetzt gehen und so tun, als wäre es zu Ende. Aber wir alle wissen ja, dass wir dann nochmal rauskommen und weiter spielen. Aber wir könnten auch einfach gleich bleiben und noch ein paar Songs spielen. Die Fans entscheiden sich umgehend und laut tosend für letztere Option.
Gesagt getan. Es folgen noch weitere fünf Halestorm Lieder und alle haben es in sich. Einmal wird von Lzzy die Teufelshand von den Fans gefordert: „Everybody Horns out!“ und dieser Forderung kommt man natürlich gerne nach – also alle! Und nachdem die Crowd bei „Here’s to us“ ausrastet, erhält sie ebenso begeistert ein Lob: „You’re fucking crazy S-tuttgart“. Beim allerletzten Song verpasst Lzzy ihren Gitarreneinsatz (was sich sehr sympathisch ausmacht), entschuldigt sich sich mit einem verlegenen „Jesus!“ und wir werden dafür noch mit einem extralangen Gitarrensolo und einer Jam-Einlage entschädigt. Das fühlt sich richtig nach Rock’n’Roll an, meine Bedenken sind nun komplett weggerockt und ich empfinde diese Hales & Co sehr sympathisch, echt und wahrlich als einen Sturm. Ich hoffe sehr, das bleibt noch lange so!