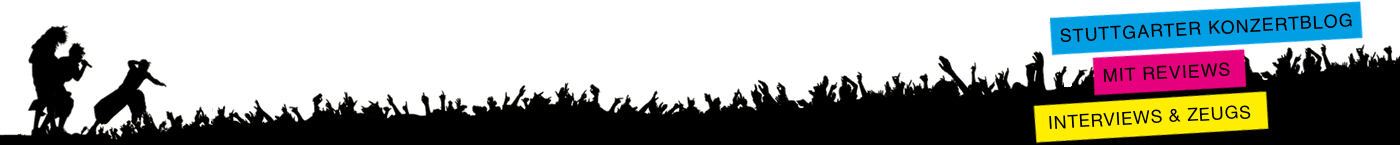BRYAN FERRY, 17.09.2015, Liederhalle, Stuttgart

„Ein Dandy tut nichts“, konstatierte Charles Baudelaire Mitte des 18. Jahrhunderts. Er sei ein Müßiggänger, der die Muße sucht: „Diese Wesen haben nichts anderes zu tun, als die Idee des Schönen in ihrer Person zu kultivieren, ihre Leidenschaften zu befriedigen, zu empfinden und zu denken.“ Als Bryan Ferry, ein distinguierter Kunststudent Mitte 20 aus Newcastle, jener vom wirtschaftlichen Untergang befallenen northern industrial town, zu Beginn der 1970er mit seiner Gruppe Roxy Music auf der Bildfläche erschien, fand nach Dave Davies von den Kinks der Typus des Dandys wieder Eingang in den Pop. Ferry war kultiviert, unglaublich charismatisch, perfekt gekleidet und extrem gutaussehend. „Was ist der höhere Mensch?“, fragte Baudelaire. „Nicht der Spezialist. Sondern der Mann der Muße und der allseitigen Bildung“, so die Antwort des französischen Literaten. Als gebildeter dressman mit Wurzeln in der Working Class schlüpfte der Sänger schnell in die Rolle, die er bis heute innehat; nämlich die des unbestrittenen ewigen Dandys, des stilvollsten Popmusikers seiner Zeit.
Nebenbei mutierte die 1971 mit dem exzentrischen Brian Eno gegründete Band zu einer der prägendsten des Jahrzehnts, die beiden Protagonisten zu Ikonen. Eno verdingte sich nach seinem frühzeitigen Ausstieg bei Roxy Music als umtriebiger Produzent und Vordenker avantgardistischen wie elektronischen Pops gleichermaßen. Frontmann Ferry hingegen veröffentlichte mit Roxy Music weitere Meisterwerke und später Saxophon geschwängerte Megaseller, während quasi nebenher eine Reihe solider Soloalben entstand.

Keine zehn Tage vor seinem 70. Geburtstag steht der Engländer nun auf der Bühne des vorzüglichen Beethovensaals der Stuttgarter Liederhalle und beglückt vor ausverkauftem Haus mit einem herrlich dekadenten über 90-minütigen Querschnitt durch seine bald viereinhalb Dekaden anhaltende Karriere. Annähernd zehn Musiker sammelt Ferry um sich, als er mit „Avonmore“ dem Titeltrack seines gleichnamigen, aktuellen, nunmehr 14. Soloalbums beginnt. Das gen Electropop pendelnde Stück mit hymnischen Refrain knüpft an den opulenten, glasklar produzierten Pop, dem Ferry solo in den 80ern und auf „Avalon“, der letzten regulären Roxy-Music-Platte frönte, an. Sein dreiköpfiger Backgroundchor ergänzt den mittlerweile von Brüchen durchsetzten Gesang.
Im exzellent geschnittenen dunklen Designeranzug mit angedeuteten roten Seitenstreifen gibt der agile, schlanke Noch-69-Jährige ein großartiges Bild ab. Das graumelierte Haar ist perfekt frisiert. Den Spuren des Alters zum Trotz wirkt Ferry kaum verändert. Der Übergang zu „Driving Me Wild“ ist fließend. Nach dem weiteren neuen Song folgt „Slave to Love“, jene aufopferungsvolle Liebeshymne zwischen Dekadenz und ennui, die die auf Hochglanz polierte Soundästhetik der mittleren 80er mit kühler Produktion, Gilmour-Gitarre und einem über allem thronenden klinischen Schlagzeugbeat mitdefinierte. Ekstatisch reagiert das Publikum auf den ersten Hit im Set. Schon jetzt deutet sich an, dass vor allem der Bombast aus Ferrys zweiter Schaffensdekade heute besonders gut ankommt.
Dramaturgisch geschickt eingefädelt, verschiebt sich das Pompöse hin zum progressiv-wavigen Glamrock des ersten Roxy-Music-Albums und dessen Hit „Ladytron“, bevor reduzierte Dylan-Cover-Versionen eingeschoben werden. Schon auf seinem ersten Solowerk „These Foolish Things“ (1973) war eine Hommage an „A Had Rain’s a-Gonna Fall“ enthalten, vor wenigen Jahren folgte mit „Dylanesque“ eine ganze Tribute-LP. Dass mit „Bob Dylan’s Dream“ (im Original auf „The Freewheelin‘ Bob Dylan“) und „Don’t Think Twice, It’s Alright“ gleich zwei Stücke seines Idols ihren Weg in die aktuelle Setlist finden, kann in der Folge wenig überraschen. Wie gut diese gelingen, ist wiederum keine Selbstverständlichkeit. Die ruhig arrangierten Versionen ziehen die Aufmerksamkeit auf Ferrys Stimme. Ohne die Verstärkung seiner Backgroundsänger zeigt er sich hier ganz in der Rolle des gealterten Dandys. Seine Posen sind zurückhaltender als sonst, stattdessen spielt er hier durchaus gekonnt Mundharmonika.

„Smoke Gets In Your Eyes“ gerät dann eine Spur zu kitschig, doch spätestens bei den Roxy-Music-Nummern „Stronger Through The Years“ (vom vorletzten Album „Manifesto“) und das wahrlich grandios gespielte Instrumental „Tara“, für das Ferry die Bühne zum Luftholen verlässt und seiner Band das Rampenlicht gönnt – und „Take a Chance With Me“, letztere vom von der Kritik ob seiner Gefälligkeit gerne verachteten letzten Album, erreicht das Konzert wieder ein exzellentes Niveau. „Out of the Blue“ vom großartigen „Country Life“ hält die Klasse und kurz darauf wird mit den schnulzigen Crowdpleasern „More Than This“ und „Avalon“ noch einmal auf Nummer sicher gegangen. Nach und nach sammeln sich Zuschauer vor der Bühne. Mutter und Tochter stehen mit auf der Bühne aufgestützten Armen vor Ferrys Klavier und himmeln ihn an. Dem Engländer, dem die Yellow Press gerne mal Affären mit den Freundinnen seiner Söhne nachsagt, scheint das für einen kurzen Moment unangenehm zu sein; gerne bezeichnete er sich in der Vergangenheit in Interviews als schüchternen Melancholiker. Jetzt wird er gefeiert und gibt mit den fantastischen Roxy-Music-Klassikern „Love Is the Drug“ und vor allem dem unwiderstehlichen „Virginia Plain“ noch einmal Musterbeispiele für sein häufig unterschätztes Songwriting. Dabei nutzt er die Euphorie für sein legendäres laszives Spiel mit Mikrophonständer und Publikum, klatscht und schnipst, dirigiert seine Band und lässt sich verdientermaßen feiern.
Zwei Zugaben – Lennons „Jealous Guy“ und etwas überraschend den Saxophon getragenen Glam-Rock-Stomper „Editions of You“ – gibt es noch; und so endet ein gutes Konzert mit einer Überraschung. Denn wer hätte erwartet, dass die B-Seite den Vorzug vor „Do the Strand“ bekommen könnte. Ferry verneigt sich noch einmal, streicht sich die berühmte Strähne aus dem Gesicht und sagt leise „Thank you“ und „Good Night“. Es sind die höflichen und ruhigen Abschiedsfloskeln des stilvollsten Protagonisten der Popmusik, eines eleganten Sängers und Gentleman. Mit federnden Schritten verlässt der in Würde gealterte Dandy die Bühne. Er mag nicht der letzte seiner Art sein, wie im Feuilleton gerne postuliert wird, doch bleibt er immer der Inbegriff eines solchen, in einer mühelosen Konsequenz, von der die später geborenen Morrissey oder Pete Doherty nur träumen können.