PHONO POP FESTIVAL, Tag 2, 11.07.2015, Altwerk Opel, Rüsselsheim

Tag 2 des Phono Pop Festivals. Bestens ausgeruht ist die Vorfreude schon groß. Das Wetter weiterhin prima, und die Organisation des Festivals von Verpflegung über Toiletten, Sitzgelegenheiten und Bühnentechnik bis hin zu den entspannten Besuchern haben uns gestern zu 100 % überzeugt. Da heute Samstag ist, geht es schon früher los, und es stehen noch mehr Bands auf dem Programm, aber wir verpassen heute nicht einen Künstler.

Zum Beispiel die Österreicher von Inner Tongue. Sie starten den heutigen Tag auf der Hauptbühne im gleißenden Sonnenlicht. Das helle Ambiente bildet so einen gewissen Kontrast zum eher dunkleren, melancholischen Indie-Pop der Damen und Herren. Was mir an der Band gefällt? Recht viele Ideen, eine gewisse Dynamik und Dramatik in ihrer Musik, und manche Songs, die mich durch ihre dominanten Synthies etwas an Chvrches erinnern. Weniger überzeugen mich die etwas larmoyante Art zu singen und die insgesamt recht vorhersehbare Art des Songwritings. Die noch nicht so zahlreichen Zuschauer stehen alle auf der schattigen Hälfte vor der Bühne wie Indie-Vampire und sehen das bestimmt genauso, bzw. natürlich total anders.

Caroline Keating darf im Anschluss auf dem komplett im Schatten sich befindenden Adamshof ran. Die Herzen von Liebhabern des Singer-/Songwriter-Genres dürften der Kanadierin zufliegen. Denn da ist zu einem ihre sehr sympathische Art sich auf der Bühne zu geben, zum anderem zeigen ihre herausragende Stimme, ihr Klavierspiel und nicht zuletzt ihre Songs, dass ihre Musik aus diesem mittlerweile riesigen Feld dieses Genres herausragen. Ich werde trotzdem nicht so ganz warm mit ihrer Musik. Das Genre der schlichten Musik, vorgetragen von Solokünstlern, zumeist etwas zu gefühlig daherkommend, ist meine Tasse nicht. Das kann aber auch am etwas niedrigen Blutdruck um diese Uhrzeit liegen. Außerdem haben sich gerade jetzt die fliegenden Ameisen entschlossen herumzuschwirren und überall an einem herumzukrabbeln, bevorzugt hier im Adamshof.

Nach einer Portion Eis mit Aspirin Plus C im Nachgang warten jetzt Still Parade auf der Hauptbühne auf mich. Und die treffen mit ihren ersten Songs aber mal so dermaßen meinen Nerv. Dachte, dass ich in Sachen softem Pop keine großen blinden Flecken, zumindest auf der deutschen musikalischen Landkarte mehr haben sollte, aber SP sind bisher komplett an mir vorbeigegangen.
Das Trio spielt federleichten Pop, der durch die Septakkorde der mit viel Flanger aufgebrezelten E-Gitarre und die unaufdringliche, aber schöne Stimme des Sängers einen raffinierten, gehaltvollen Touch erhält. Man könnte sich diese Musik perfekt im Italien oder Frankreich der frühen 80er vorstellen. Vielleicht hält die Begeisterung der Überprüfung daheim nicht mehr stand, aber hier und jetzt, bei 30 Grad im Schatten und hellem Sonnenlicht, bin ich enormst angetan. Irgendwo zwischen F.R. David, Orwell, Phoenix, mit einer Prise Dream Pop. Die letzten beiden Lieder, die etwas gewöhnlicher nach normalem Indie-Pop klingen, ändern da auch nix mehr an meiner positiven Meinung.

Von einem Höhepunkt zum nächsten. John Bramwell, der nicht nur musikalisch ein Konzert vom allerfeinstem geben wird, sondern auch so eine unfassbar gewinnbringende, kumpelige Art hat, dass man sich auf jede seiner Ansagen genauso freut wie auf seine Musik. Der Sänger und Gitarrist, sonst hauptberuflich bei I Am Kloot, wirkt etwas gehetzt aber bestens gelaunt, als er auf die Bühne kommt, und erklärt erst mal warum. Er sei erst vor einer Stunde am Flughafen angekommen, und seine Gitarre ging verloren. Ob er deswegen die ausgeliehene Ersatzgitarre ohne Gurt im Stehen spielt?
Das macht sein Gitarrenspiel aber nicht schlechter. Mit Singer/Songwriter hat das Ganze hier nichts zu tun, obwohl man das denken könnte. Da greife ich lieber auf Eric Pfeil zurück, der den etwas staubigen Begriff „Liedermacher“ zu neuen Ehren kommen lässt. Im allerbesten Sinne durch und durch britisch klingt die Musik von Mr. Bramwell. Nicht so exzentrisch wie ein Robyn Hitchcock, aber die Harmonien sprengen den üblichen Rahmen seichten Singer/Songwritertums. Zudem weist das Gitarrenspiel soviel dynamische und technische Fertigkeiten auf, hat seine Stimme so eine prägnante Art, dass man ganz gefesselt ist. Man merkt das auch an der Art, wie die Leute zuhören.

Sollte tatsächlich mal jemand etwas reden, wie in der ersten Reihe, löst das John so dermaßen charmant („mich stört das nicht, aber die Leute dahinter ‚might get pissed’“, gefolgt von einem Lachen), dass die Atmosphäre maximal gelöst ist. Da er „also lost my smartphone“, darf unser Fotograf Micha auf die Bühne und das Publikum fotografieren. Alles ganz unkompliziert in der Welt von John Bramwell. Und über die Art wie er erzählt, dass er beim Autofahren seine eigene Platte angehört und dabei gedacht hat „this is fucking brilliant“, werde ich noch lange schmunzeln (*schmunzel, schmunzel*). Spitzentyp, cheers Mister Bramwell!

Tiger Lou kommen aus Schweden und sind die Band auf dem gesamten Festival, mit der ich am wenigsten warm werde. An der mangelnden musikalischen Qualität liegt es aber auch hier nicht. Der Bandsound ist super tight, da wackelt nix, und die Band weiß ebenfalls dynamisch zu überzeugen, v.a. in den Momenten, wenn sie Gitarrenwände aufschichtet. Für mich klingt es trotzdem zu sehr nach so Indie, wie ihn eben Menschen mit so Frisuren machen, und wie er problemlos samstagabends in der Indiedisco oder ganztags im Radio laufen könnte. Da ändert auch eine Amanda, die sich zwischendurch mit einer Trompete dazu gesellt, leider nichts.
Da die Musik von TL mich nicht so fesselt, bleibt Zeit für die Beobachtung, dass hier nur wenige Suffis unterwegs sind im Vergleich zu anderen Big Festivals. Das macht das Ganze natürlich für jemanden wie mich, der eher wegen der Musik als wegen der Party da ist, angenehmer. Ein paar torkeln aber auch schon jetzt, am frühen Abend, rum. Aber wir sollten die Leute schwankenden Ganges und glasigen Blicks nicht tadeln, denn sie finanzieren durch ihr Alkoholproblem solche Events mit, denke ich mir. Und solange sie so wenige und dabei so harmlos sind, ist es eher putzig als störend.

Kommen wir nun zu etwas ganz Anderem: Schnipo Schranke. Auf das Damen Duo bin ich sehr gespannt, denn viele Typen, die ganz in Ordnung sind, mögen die. Für ihren Auftritt werden sie bei manchen Songs noch von einem Mann Gereonklughafter Gestalt und Aussehens an einem Mini-Synthie unterstützt. Meine Erwartung gehen in Richtung dilettantischem Lo-Fi Geschrammel. Ist aber gar nicht so.
Also Lo-Fi ist es schon, aber viel musikalischerer und netter anzuhörender Pop als ich erwartet hätte. Da viele Worte in den Texten untergebracht sind, nimmt der Gesang teilweise einen fast hiphop artigen Charakter an. Fast, weil immer noch gesungen und nicht gesprochen wird. Es gibt nette „Bababahs“-Chöre, ein wenig Gegengesang, und ob jetzt Daniela oder Friederike am Klavier bzw. Schlagzeug sitzen oder umgekehrt, die Musik verändert sich nicht groß.
Die Musik von Schnipo Schranke lebt von den gelungenen, einfachen Melodien, der direkten Rotzigkeit des Ganzen und natürlich von den Texten. Eine so lustige wie intelligente Mischung aus Teenage-Love-Drama mit absurden Twists und viel direkt benanntem Untenrum. Für ihre Ansagen „Wir haben kein Merch dabei, weil wir nicht so geildgeile Schweine sind wie die anderen“ und „Wir spielen mittlerweile nur noch für vierstellige Beträge“ und „Nur weil wir links sind, heißt das nicht, dass wir in eurem Jugendclub spielen“ und „Danke, ihr sexy Rüsselsheimer“ muss man sie einfach ins Herz schließen.

Mit Okta Logue stehen quasi Lokalmatadore als nächstes an. Über die vier Darmstädter habe ich schon viel Gutes gehört, jetzt sehe ich sie, wie eigentlich alle Bands hier außer Erlend Øye, zum ersten Mal. Der Vergleich „Pink Floyd“ geisterte des Öfteren durch den Raum, kam man auf die Band zu sprechen.
Stilistisch und vom Sound scheinen sich OL auf jeden Fall stark an den 70ern zu orientieren. Die Orgel doppelt mal fett die Gitarrenriffs, mal kommen Jean Michel Jarre oder an Alan Parsons Project erinnernde Klänge hervor. Bei einigen Gitarrensolo-Passagen drängt sich dann tatsächlich der Vergleich zu Pink Floyd auf. Gilmour ahoi, aber ich mag das ja. Was mir so auf Anhieb nicht gleich gefallen mag, ist der etwas zu farblose Gesang, und auch die Kompositionen scheinen mir nicht immer das Ergebnis der ultimativ zündenden Idee zu sein. Andererseits merkt man in manchen Instrumentalpassagen, wie gut die Band in ihren guten Momenten sein kann. Vorsatz: muss die mal in einem kleineren Club sehen.

Kaum zu glauben, aber in den letzten Jahren habe ich es tatsächlich geschafft, als Stuttgarter von Die Nerven weder einen Song zu hören, geschweige denn ein Konzert zu sehen. Bei All Diese Gewalt, Melvin Raclette, Levin Goes Lightly, überall tauchten diverse Musiker der Band auf, aber Die Nerven selbst, Fehlanzeige. Vielleicht habe ich was verpasst, vielleicht ist es aber auch besser so, und ich erlebe sie gerade in ihrer vollen Blüte. Denn was die Drei hier machen, ist mit „beeindruckend“ nur sehr zurückhaltend umschrieben.
Wie ein Tornado oder eine Vulkaneruption wirkt der Auftritt der Gruppe im bisherigen Festival-Kontext. Mit einer Urgewalt, als würde Hulk einem persönlich in die Fresse zimmern, legen die ein Set hier hin, dass einem nur der Kinnladen runterklappt. Der Sound ist ein Mischmasch aus Noise-Alternative-Gitarrenzeug der 90er, gemischt mit früh 80er Wave, samt krautigen, stumpfen Instrumentalpassagen, garniert mit einer unfassbaren Wut und Spielwitz. Selbst wenn man nicht Fan dieser Musikrichtung ist, lässt einen dieser Auftritt nicht kalt.
Das alles wirkt so zwingend, so voller Energie und in keinster Weise ausgelutscht. Kevin Kuhn trommelt sich gekonnt einen ab, und die Interaktion zwischen ihm und dem ekstatisch schlaksenden Gitarristen Max Rieger wirkt besonders. Die verstehen sich. Definitiv ein absolutes Festival-Highlight, und über das kommende Album auf Glitterhouse Records darf man sich auch schon freuen.

Nach diesem Auftritt wird es schwierig, sofort wieder Begeisterung aufkommen zu lassen. Erschwerend kommt bei Two Gallants hinzu, dass mir weder der Gesang noch die etwas zu cleane musikalische Reise durch Amerikas Musikgeschichte wirklich gefällt. Das musikalische Können steht aber außer Frage. V.a. der Gitarrist spielt nicht nur komplizierte Parts sauber und fehlerfrei, auch Fingerpicking ist ihm nicht fremd, und Klavier spielen tut er auch bei manchen Stücken. Aber Mundharmonika, ein Song, der in Richtung irish-folk geht, zu vieles an Zutaten, mit denen ich mich schwer tue. Ein schwerer, bluesiger Song, dem etwas vom Schmutz der ersten Led Zeppelin Alben anhaftet, versöhnt mich dann aber noch ein wenig.

Als Überbrückung zum zweiten Headliner Temples kann man noch zum Überraschungsgast rüberspazieren. Der Name sickert tatsächlich davor nicht durch, und so erfahren wir erst während des Auftritts, dass wir es mit Trip Ad Lib aus Mainz zu tun haben. Schönen, handgemachten House gibt es, und die Visuals unterstreichen das in der Dunkelheit noch eindrucksvoll. Klingt warm, dynamisch, und trifft die richtige Mischung aus chillig und tanzbar genug. Ein gelungenes Intermezzo, und der letzte Auftritt im Adamshof.

Und jetzt wird man schon ein wenig wehmütig, denn die Temples werden tatsächlich der letzte Act überhaupt auf dem Phono Pop werden. Zu diesem Anlass kommen die Veranstalter Florian und Carsten auf die große Bühne. Es gibt noch eine angenehm unsentimentale, aber schöne Abschiedsrede mit Dank an alle Mitarbeiter und Helfer. Irgendwie bitter, dass so ein Festival nicht mehr weitermacht, während andere, größere Veranstaltungen mit ihrem uninspierierenden Programm weitermachen können. Ach, ach, klag, klag, hilft alles nix.

„Sun Structures“, das Debütalbum der Temples, war letztes Jahr einer meiner Favoriten. Die vier schmalen Boys mit den guten Frisuren sind uns am Nachmittag schon in der Fußgängerzone über dem Weg gelaufen. Hier auf die Bühne mit dieser tollen Beleuchtung passen sie definitiv besser hin. Sieht schon mal sehr stimmig aus, der Sound zum Opener „Sun Structures“ ist anfangs allerdings etwas unausgewogen.
Der Bass zu laut, die Gitarre und die Stimme zu leise, geht etwas von der Charakteristik des Temples Sound verloren. Ein paar Leute der Organisation zünden derweil zum Phono Pop Abschied Leuchtfackeln an und laufen damit durchs Publikum. Farewell Phono Pop.
Der Klang wird mittlerweile aber besser, es mangelt ihm aber immer noch ein wenig an Dynamik. Egal, die Songs der Briten sind trotzdem gut zu hören, und man kann sich so der retroseligen Melodiösität der Musik erfreuen. Besonders toll ist „Sand Dance“ mit seinem orientalischem Schick.

Irgendein Zuschauer übertreibt es derweil mit dem Imitieren der seligen 60ies und hüllt mich in eine Wolke aus übelst stinkendem Hash. Raucht Gras, Leute, das riecht nicht so unangenehm. Mit „Mesmerise“ gibt es derweil einen weiteren, überragenden Hit. Ebenso toll ein neuer, noch nicht veröffentlichter Song. Scheint etwas komplexer als das bisherige Material zu sein, klingt aber trotzdem sehr nach Temples und geht gut ins Ohr.
So findet das Phono Pop gegen kurz vor ein Uhr einen sehr würdigen Abschluss seiner zehnjährigen Biographie. Dass wir es erst jetzt hierher geschafft haben, ist wirklich bitter. Aber so behalten wir es als absolutes Juwel in Erinnerung, und wer weiß, wenn Bands ständig wieder Revivals haben, wieso sollten das nicht auch Festivals? Wir wären wieder sehr gerne dabei.

Inner Tongue
Caroline Keating
Still Parade
John Bramwell
Tiger Lou
Schnipo Schranke
Okta Logue
Die Nerven
Two Gallants
Trip Ad Lip
Temples
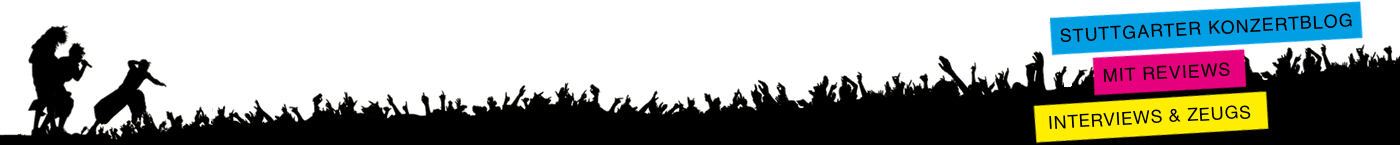












































































































Preis für die gargantueskeste Review ever. Fett.