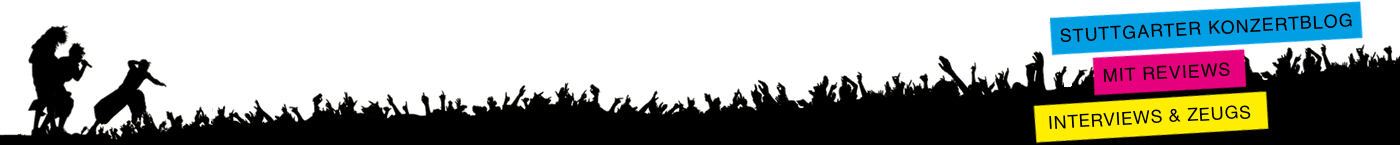MAIFELD DERBY, 22.05.-24.05.2015, Reitstadion/Maimarktgelände, Mannheim

Steckenpferde, Blumenkränze in wallenden Haaren, Musiker mit „Ich fass es nicht“-Ausdruck im Gesicht, großes Indie-Kino, Singer/Songwriter-Überflieger, Pop und Ramba-zamba, Amore und Bologna. Da ging was beim 5. Maifeld Derby, wobei vielleicht dieser Blitz aus heiterem Himmel, der kribbelkrabbel-schöne Killer-Dolchstoß von hinten in den Rücken, der wahre Mega-Coup am Ende doch fehlte. Klar: „The National“ in Bestform wie im Vorjahr können nicht jedes Jahr spielen. Aber wer möchte schon bei einem solch hohenProgramm-Niveau den Kritiker geben. Drei Tage, vier Bühnen, und maximal fünf kleine Enttäuschungen – zum Teil den eigenen hohen Erwartungen geschuldet. Das konnte sich also sehen und hören lassen. Das Derby ist noch immer eine Klasse für sich.
Und zudem ein echtes Wohlfühl-Festival für alle Besucher, die nicht nur auf richtig gute Live-Musik stehen, sondern zudem keinen Bock haben, abgezockt zu werden. In diesem Jahr bekam man für die eigene Festival-Währung, den Derby-Dollar, neben Handbrot, Currywurst und Maultaschen auch Kuchenburger mit frischen Erdbeeren, erstklassigen Cappuccino, faire Limo oder lokales Bier. Friede, Freude, Erdbeerkuchen also.
An drei Tagen wurden laut Veranstalter Timo Kumpf rund 13 000 Zuschauer gezählt. Das Programm auf vier Bühnen war noch vielfältiger, und neben reichlich Musik ohne wirkliche Ausfälle gab’s Kurzfilme, einen Poetry Slam, eine Open-Air-Galerie und das spaßige Dressurreiten auf Steckenpferden an gleich zwei Tagen. Im Mittelpunkt stand auf dem Gelände am Mannheimer Reitstadion aber wie immer die Musik. Leider mussten wir staubedingt „And The Golden Choir“ verpassen, denn das Vinyl-Halbplayback des wunderbaren Tobias Siebert, wurde vorgezogen. Man hörte erwartungsgemäß viel Gutes von diesem Konzert.
Get Well Soon waren dafür etwas später dran, denn Georg-Büchner-Preisträger Arnold Stadler, der in den vergangenen Monaten mit dem Schwabenkollegen Konstantin Gropper angebandelt hat, war im Bahn-Delay. Später dann allerdings auch im Lesungsmodus und zwar ohne Pop-Scheuklappen. Eine Weltpremiere – weitere gemeinsame Ausritte sind geplant, zum Bespiel zur Veröffentlichung des nächsten Stadler-Romans. Noch einen Happen feinen Ghostpoet-Rap mitnehmen, später dann die Russen Motorama unter freiem Himmel auf der Fackelbühne. Je weiter man sich von der Bühne entfernt, desto deutlicher wird am Ende des Sets das wackelige Zusammenspiel. Vielleicht haben sich die Männer um Sänger Vlad Parshin beglückt vom euphorischen Publikum doch etwas zu sehr in Rage gespielt.
Gisbert zu Knyphausen schlägt sich im gut gefüllten Palastzelt wacker, und doch würde er viel besser in einen Club passen – oder einen Weinkeller. Und irgendwie ist es auch nicht wirklich essentiell, was der sympathische Sänger da so macht. Ans Eingemachte geht es bei anderen Künstlern. Die Allah-Las aus Los Angeles beispielsweise. Sie sehen nicht so aus, tauchen aber ganz tief in die Psychedlic-Rock-Hippie-Zeit ein. Eigentlich müsste man sich dazu im Zeitraffer die Haare wachsen lassen und dumme Sachen machen, an die man sich am nächsten Morgen nicht mehr erinnern kann. Retro, Gier nach Authentizität? Nöö, das kommt tief aus dem Bauch.
Bei Manu Delago Handmade kommt alles aus der Hang, diesem unterschiedlich gestimmten Perkussionsinstrument, dessen Sound-Ursprung vom Ölfass herrührt. Was Delago und seine drei Mitstreiter bieten, befruchtet das Brachland zwischen Pop, Elektronik und Jazzrock – virtuos, furios. Zu später Stunde dann noch der Schwede José González, mild lächelnd und geerdet in Melancholie. Als Singer/Songwriter-Solist ist er ja inzwischen viel erfolgreicher als mit seiner Band. Und doch muss man der musikalischen Vielfalt und den kleinen eruptiven Momenten von Junip nachweinen. Auch wenn sich beim Derby in die Lieder bisweilen auch Afrobeats schmuggeln, auf der Langstrecke ist die Show around Midnight doch ein wenig zu eintönig.
Der Samstag wird zum Parcours für fleißige Bühnenhopper. Und zur großen Stunde für Menschen, die sich einfach nur eine akustische Gitarre um den Hals hängen, singen und eine komplett gefüllte Tribüne von den Sitzen reißen. The Lake Poets, eigentlich nur ein Poet, gelingt das, die Standing Ovations für Sänger Charles Cunningham sind dann noch deutlicher. Er kann’s kaum fassen, was im Reitstadion los ist. Und so ergeht es an diesen drei Tagen einigen Musikern, die sonst üblicherweise in Clubs und kleinen Läden spielen und hier nun die große Show stehen müssen. Oft kappt’s, bisweilen ist die Emotionalität der Augenblicke bis in die letzte Reihe zu spüren. Wow-Momente eben. Auch bei Musée Mecanique den Großmeistern aus Portland. Und doch hat man sie schon intensiver erleben dürfen. Husky nutzen später auch die dritte Chance beim Derby. Aufbauprogramm im besten Sinn des Wortes.
Open Air geht’s in die Vollen. Die US-Überflieger Brand New geben sich wie Stars und rocken mächtig. Tagsüber hängen die Jeans zum Trocknen vorm Tourbus, am Abend werden sie wieder durchgeschwitzt. Gar kein Halten gibt’s bei Foxygen. Sam France wird im Hosenanzug zum völlig durchgeknallten Dieter Thomas Kuhn. Dazu drei ebenso auf-gedrehte Sängerinnen und Tänzerinnen, immer neue Wendungen zwischen Beatgewitter, Trash und Rocky Horror-Glittershow. Ein mitreißender Overkill für die Sinne.
Im großen Zelt können die drei Landauer Indie-Bubem von Sizarr beim Fast-Heimspiel einen Punktsieg einfahren. Ganz so leicht wie erwartet wird’s aber doch nicht. Ganz anders Mogwai: Im Auftürmen von Gitarrenschichten und schwebenden Sounds, die dann zum Donnergrollen werden, sind sie Weltmeister. Beim Derby sind sie in Bestform am Start. Man kann die knisternde Spannung, den Prozess fühlen und spüren. Mogwai reißen mit und man lässt sich gerne in den von ihnen entfachten Strudel fallen. Zuvor haben bereits die smarten Indie-Allrounder Archive die Stange hochgelegt, glasklar kalkuliert, elektronisch aufpoliert, glänzend und durchaus auch ergreifend.
Der Sonntag ist bei Festivals häufig der Tag, an dem es konditionell beim Publikum an die Reserven geht. Beim Derby fällt das Durchhalten leicht. Drangsal, der eigentlich Max Gruber heißt, und aus Herxheim stammt, setzt mit Elektro-Punk-Wave-und-mehr starke Akzente im Brückenaward-Zelt. Die mit Spannung erwarteten Dänen Mew kommen leider gar nicht in Fahrt und liefern ihre komplexen Songs wie nervige Oberschüler ab. Dafür lassen es die von zwei Drummern angeschobenen Thee Oh Sees mordsmäßig knallen. Was einmal aufgeforstet war, wird platt gerockt, der Parcours gefühlt in Trümmern, das Mikrofon tief im Hals; trotzdem kein Gewürge, sondern Rabatz.

Wie auch bei den Österreichern Wanda, die heftigst zelebrieren, was man so eigentlich nie wieder hören wollte. Austropop mit dicker Hose und ganz viel Amore. Marco Michael Wandas findet mit Indie-Starappeal und offenem Hemd genau die Mitte zwischen Falco, Wolfgang Ambros und Starschnitt-Held. Das Maifeld tanzt ausgelassen, singt, schreit, feiert.
Fink, nicht erst seitdem einer seiner Songs auf den Soundtrack des Films „Honig im Kopf“ gepackt wurde, eine feste Größe, hält dagegen. Atmosphärisch, mit unterschwelligem Groove und viel Blues in den Saiten. Der Brite mit der eindringlichen Stimme spielt sich in Trance, das Publikum geht mit, der Sound ist fantastisch und breitwandig. Moloko-Sängerin Róisín Murphy legt dagegen einen tanzbaren wie glamourösen Auftritt zwischen Techno, Disco und Gaga hin. Während hinten am Elektronik-Sammelsurium geschraubt wird und die Drum-Fetzen fliegen, gibt sie die Rapperin mit Schlüsselgewalt. Sie tanzt, räkelt sich, doch jenseits aller Posen und Rollenspiele wird sie im positiven Sinne übergriffig, reißt mit, feuert an. Es wird getanzt, viel getanzt, selbst zu akustischem Bossa und die Stimme ist da – und wie. Im Glitzerkleid verlässt sie am Ende die Bühne, leuchtend gefeiert. Abschluss eines wunderbaren 5. Maifeld Derby.