NICK CAVE, 07.05.2015, Liederhalle, Stuttgart

Wir sollten uns freuen. Freuen, dass Nick Cave kein Sektenführer ist. Klar, ist er ja irgendwie, ich meine aber einen richtigen. Mit Dachschaden und Mission. Ein Kommando aus dem Mund von Mister Cave, und der ausverkaufte Beethovensaal der Liederhalle hätte ohne mit der Wimper zu zucken kollektiven Suizid begangen. Wäre eine gute Schlagzeile gewesen: „2.000 Tote bei Rockkonzert. Hatte der Teufel seine Finger im Spiel?“ Und zumindest da muss man ganz klar sagen: Ja, hatte er. Anders ist das nicht zu erklären. Das, was jetzt hier kommt, ist kein Konzertbericht. Wie auch, wenn das, was sich am Donnerstagabend in der Liederhalle zugetragen hat, kein Konzert war?
Es war… ach zum Teufel mit den Klischees, es war ein Ritual, eine Messe, dirigiert von Nick Cave, jenem 57-jährigen Australier, der öfter durch die Hölle gegangen ist als es gut sein kann für einen Menschen, der mehr Charisma hat als gut ist für die ersten Reihen bei einem Konzert, der es wie kaum ein anderer beherrscht, die blasse Hülle eines Live-Konzerts abzustreifen und in etwas anderes zu verwandeln. Etwas Spirituelles. Etwas Verruchtes. Etwas Leidenschaftliches. Etwas Dunkles. Der schwelende Einstieg mit „Water’s Edge“, an sich schon ein genialer Kniff, bei dem seine Band, die aus vier Bad-Seeds-Schurken besteht, in abgehackter Impulsivität erstmals vorstellig wird, dann der „Weeping Song“, statt trunkenem Seemanngeschunkel solo dargeboten an seinem Flügel, sein Gesang flehend, sein Blick suchend. Und bei „Red Right Hand“ passiert das Unausweichliche. Cave, in perfekt sitzendem blauen Anzug und weißem Hemd, steht auf, ein vielsagender Blick, eine knappe Ansage, eine Handbewegung. Mehr braucht es nicht, um einen Damm zu brechen. Von allen Seiten fluten hunderte Menschen in Richtung Bühne, sie wollen nicht sitzen, sie wollen stehen, tanzen, sie wollen ihm nah sein. Sitzplatzkonzert? Von wegen. Ausnahmezustand in der Liederhalle. Und es fühlt sich gut an.
Wie er an seinem Flügel sitzt, Notenblatt nach Notenblatt mit einer elegant-beiläufigen Handbewegung wegwirft, wie er auf der Bühne auf- und abschreitet wie ein hungriger Wolf, den Blick auf die Menge vor ihm gerichtet, auf die betörten Augen, wie sich ihm die Hände der Menschen in den ersten Reihen entgegenstrecken wie einem Heilsbringer, der sie wieder gehen oder sehen lässt, wie sich sein Schatten wie bei einem gealterten Peter Pan an der Hallenwand selbstständig macht, riesenhaft anschwillt, die Leute verschlingt und dann wieder verschwindet, wie er singt, flüstert, leidet, knurrt, schreit, seufzt, wie er seine Geschichten vom Tod, von der Hölle, von der entsetzlichen Schönheit der Liebe inszeniert, wie er tanzt, wie seine stechenden Augen die Menge durchbohren. Das, Ladies and Gentlemen, ist nicht von dieser Welt. Cave weiß das. Unnahbar ist er immer noch, unerreichbar, doch gleichzeitig sucht er das Spiel mit dem Publikum, berührt Hände, kniet vor den ersten Reihen nieder.
Er ist wahrlich ein Musikant des Teufels, ein Sünder, der verführt wurde und verführen will. Aber er macht das heute anders als damals, als er sein Publikum offen missachtete, als er ein Verlorener war, ein Getriebener im Sumpf aus Drogen und Ruhm. Heute wickelt er die Menschen mit Charisma und Sex-Appeal (oh ja!) um die Finger. Und natürlich mit seinen Liedern. Über zwei Stunden lang hält er die Liederhalle mit seiner fantastischen Band in Atem, bringt das fiebrige Crescendo „The Mercy Seat“ als elegische Pianofassung, macht aus dem ruhigen „Higgs Bosom Blues“ im Gegenzug eine dröhnende Explosion, einen intensiven Aufschrei, der an diesem Abend immer mal wieder die Ruhe zerfetzt. „Tupelo“, „Jack The Ripper“, Songs wie diese leben von der mörderischen Dynamik, von den ganz ruhigen und ganz lauten Momenten, die alles verschlingen. Und vom einzigartigen Zusammenspiel. Natürlich sitzt da Zottel Warren Ellis auf seinem Stuhl wie in einem Schaukelstuhl auf einer Südstaatenveranda, statt einer Knarre eine Gitarre in beinahe obszöner Geste auf dem Schoß, der Blick wirr, die Bewegungen zappelnd, sein Spiel betörend. Im Laufe des Abends spielt er gefühlt zwanzig Instrumente, stimmt mit den Kollegen Martyn Casey (Bass), Thomas Wydler (Schlagzeug) und Barry Adamson (Keyboards) hin und wieder auch in den Chor der Verdammten ein, der so gut zur Apokalyptik des Cave’schen Werks passt.
Die Ekstase auf der Bühne fließt in dichten Strömen ins Publikum, ebenso Aura und Charisma Nick Caves, das ihm in Wogen entströmt als trüge er ein schweres Parfum. Als es mit den sphärischen Klängen von „Push The Sky Away“ seinem Ende entgegengeht, fällt es für den Moment schwer, sich zu orientieren. Aber da ist man schon dreimal gestorben und wiederauferstanden. War das ein Blick in die Hölle? Oder doch eher ins Paradies? Wer weiß das schon. Nur eines ist sicher: Mit dem Diesseits hatte das nichts zu tun.
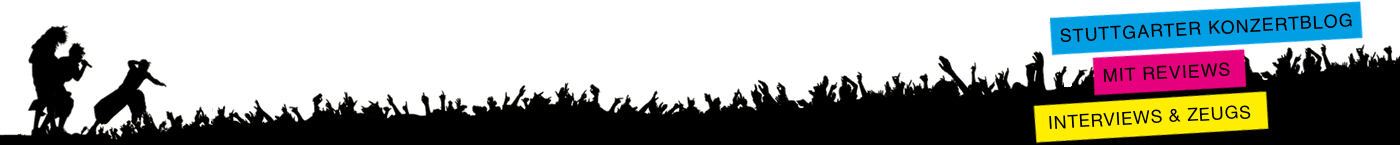
Chapeau! Ein unbeschreibliches Ereignis treffend beschrieben. Kann man kaum besser machen.
Großartiger Bericht!
Danke schön.