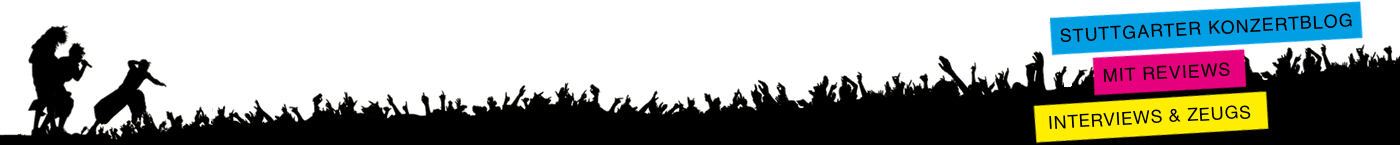DREAM THEATER, 15.02.2012, Liederhalle, Stuttgart

Die Situation hatten wir jetzt auch schon paar Mal. Der Herr meint auf ein Konzert alter Heroen gehen zu müssen. Alt im Sinne von verblichener Heroen, sprich, vor über 20 Jahren als einer der wenigen damals das Debütalbum „When Dream And Day Unite“ gekauft, für paar Jahre Fan gewesen, aber seit „Awake“ nichts mehr mitbekommen. Und so einer meint dann also irgendwas Substantielles schreiben zu können. Nee, kann er natürlich nicht, aber er kann sein Trauma aufarbeiten, damals, Anfang der 90er, vor der ausverkauften Rofa gestanden zu sein, und seine damalige Lieblingsband nicht gesehen zu haben.
Wenn man Prog geil findet, ist man ja was die Kuhlness angeht gesellschaftlich immer noch komplett unten durch. Man hat also als Hörer dieser barocken Kopfmusik schon komplett mit der Idee abgeschlossen, irgendwie hot, hip oder sonst wie zeitgemäß attraktiv zu wirken. Was ja eigentlich auch schon wieder ’ne geile Haltung ist, und damit schon wieder hip, aber halt eher so Avantgarde. Diese auf extrem dünnen Eis schlitternde These kann man ja mal so lange unwidersprochen im Raum stehen lassen, bis Lark’s Tongues In Aspic von King Crimson Samstagabends in der Indie-Saufdisco gespielt werden wird. Bis dahin macht es man sich in seiner hipsterfreien comfort zone mit 20minütigen Gitarrensoli bequem.
Im gut gefüllten Hegel-Saal ist schon die Vorband Periphery am Tun und Machen. Drei solierende und riffende Gitarren. Gut, dass heute einer der zwei Tage im Jahr ist, an denen ich Kopfschmerzen habe. Fight fire with fire. Komplexer Metal wird hier geboten, recht hart, mit einem Sänger, der mal tiefer brüllt, mal höher und klar singt. Bei letzteren Passagen denke ich, dass ich mal wieder mein Fates Warning Vinyl hervorkramen könnte. Aber natürlich ist das Ganze moderner, was bei den Nu-Metal artigen Parts mit Tiefton-Geriffe deutlich wird. Der Sound könnte besser sein, aber komplizierte Musik, drei verzerrte Gitarren und großer Saal, keine einfach Übung.
Dass hier technisch anspruchsvollere Musik gemuckt wird, merkt man auch optisch. Die Gitarren hängen höher Richtung Kinn als in anderen Genres (vgl. Sleaze- bzw. Punkrock). Nach ca. 25 Minuten erfolgt die Ankündigung des letzten Songs. Der Aussage muss man in diesem Genre aber eine andere Bedeutung beimessen: weitere 15 Minuten gibt’s im Klartext. Auf jeden Fall kommt die Band gut an, und wird mit viel Beifall entlassen.

Nach recht kurzer Umbaupause starten Dream Theater um 20:40 Uhr mit einem bombastischen Intro ihr Set. Sehr hübsche Bühnendeko, bei der auf drei Vierecken Bühnen-Livebilder oder anderes Videomaterial projiziert werden. Aus der Trommelburg könnte Meg White sich übrigens ca. 15 Drum-Kits basteln. Der Sound ist anfangs noch nicht so perfekt, wie es wünschenswert wäre, aber es wird ein wenig besser im Laufe des Konzerts. Nach dem zehnminütigen „Bridges In The Sky“ folgt schon der erste mir bekannte Song, „6:00“ vom „Awake“ Album. Der Keyboarder hat ein drehbares Podest, die Band ist in Bewegung, der von weitem immer mehr an Big Lebowski erinnernde James LaBrie ist gut bei Stimme. Doch, das macht Laune, aller Frickelei und Virtuosität zum Trotz. Oder gerade deswegen?

Eigentlich habe ich mich ja schon länger von dem Gedanken gelöst, dass gute Musik etwas mit extrem guter Beherrschung der Instrumente zu tun haben muss. Das Ganze artet ja dann gerne mal in onanistischem, songundienlichem Narzissmus aus. Aber auch hier muss man differenzieren. DT haben starke Songs, wie man an der Hook von „Build Me Up, Break Me Down“ hören kann, und schaffen es sogar ein Schlagzeugsolo, ansonsten die Höchststrafe bei einem Konzert, interessant zu gestalten. Dazu noch eine Bemerkung, was Mike Mangini bei seinem Solo abzieht lässt einem wirklich die Kinnlade nach unten klappen. Cyborg, Gentechnik, oder Außerirdischer, das sind meine Theorien. Abartig!

Obwohl hier in fünf Sekunden mehr Noten gespielt werden als während eines ganzen Bohren & Der Club Of Gore-Konzerts, sind die Kopfschmerzen passé. Am besten gefallen mir natürlich die mir bekannten Songs, da es im Normalfall etwas 50 Durchgänge braucht, bis sich ein Progrocksong in meinem Gehörgang mal etabliert hat. Schön, dass sie „Fortune In Lies“ vom Debütalbum spielen. Bei John Petrucci wird es zwar langsam etwas licht auf der Birne, aber egal, Hauptsache er bekommt keine Gicht. Unfassbar was der Mann an der Gitarre fabriziert. So für eine Minute würde ich auch gerne mal wissen wie es sich anfühlt, wenn man so Gitarre spielen kann. Ebenso technisch überragend natürlich John Myungs Bassspiel, der jetzt, sagen wir mal, einen anderen Ansatz verfolgt als zum Beispiel Lemmy. Und noch einen Hinweis an etwaige Indieleser: Mars Volta super finden, und das hier doof, ist nur so halb logisch.
Kritikpunkte: der Sound könnte etwas perfekter sein, gerade bei den lauten, schnellen und hektischen Sachen wird’s dann manchmal doch etwas verwaschen. Und die Animation mit einem Jungen, der auf einem Einrad auf einem Hochseil balanciert während des eh schon leicht kitschigen „Beneath The Surface“ nähert sich für mich etwas zu sehr PUR-suspekten Gefilden an.
„The Spirit Carries On“ erinnert mich in seinem textlichen Pathos mal kurz an Manowar, musikalisch klingt’s aber nach der ganz großen „Lebewohl-wir-werden-uns-aber-irgendwann-mal-wieder-sehen“ Abschiedshymne. Ist aber noch nicht das Ende. „Breaking All Illusions“ ist der letzte Song vor der Zugabe „Pull Me Under“. Ein Beinahe-Hit Anfang der 90er, so Sachen liefen damals im MusicTeleVision. Über zwei Stunden geht das ganze Spektakel übrigens.
Punk ist das ja alles nicht, aber das sehe ich protestantisch. Man kann sich auch ein wenig Mühe geben beim Instrumente lernen, anstatt sich immer nur besoffen in die Hosen zu pullern. Am besten gleich mal hiermit anfangen.