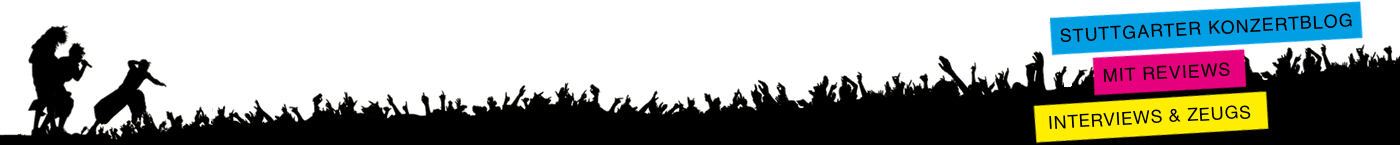OPETH, 30.11.2011, LKA, Stuttgart

Opeth-Konzerte sind phantastisch. Die Band liefert sogar die journalistische Aufbereitung gleich mit:
„We are Opeth from Stockholm, Sweden. What we do is, we entertain people by playing music. We put out records, then we play live and I tell jokes. This pretty much sums up our whole career.“
Eigentlich alles gesagt, oder? Aber Musik-Fans wollen ja immer mehr und mehr!

In der Tat ist es ja eine beachtliche Karriere, welche die Band seit ihrem Debüt „Orchid“ (1995) hingelegt hat. Nicht nur, weil sie großen internationalen Erfolg erreichte und sich damit den Musikertraum erfüllen konnte, von der Musik auch leben zu können, sondern weil sie nie in jene gefährliche Falle für Künstler aller Gattungen tappte, sich nur noch selbst zu kopieren. Bevor man sich musikalisch selbst kopieren kann, muss man sich allerdings erst zwischen der Musik positionieren, die es bereits gibt. Opeth haben auch da nicht (nur) kopiert, was es schon gab, sondern sich von der Death Metal-Konkurrenz abgesetzt, indem sie deren Schaffen überboten und stilistisch so weit abwichen, dass sie sich eine eigene Stilnische schufen, in welcher sich bis heute fast nur Bands tummeln, die ihrerseits Opeth in der einen oder andere Weise nacheifern wie Behind the Scenery oder Dark Suns, um zwei deutsche Beispiele zu nennen.
Seit „Morningrise“ (1996) wurde die Überbietung – so der rhetorische Fachbegriff – zum zentralen Gestaltungsprinzip von Nachfolgealben – gepaart mit einer stetig leichten Abweichung, noch so ein Fachbegriff – durch welche die Band anderen immer eine Nase voraus war und ihnen etwas gab, woran sie sich abarbeiten konnten. Das muss man aber auch schaffen: Ein hohes Niveau nicht nur zu halten, sondern immer wieder zu überbieten. Dazu braucht man schon einen Songwriter wie Mikael Åkerfeldt. Man kennt ja diese Das-erste-Album-war-eh-das-beste-Bands. Aber Opeth haben es ausnahmslos geschafft mit jedem Album die Frage aufzuwerfen, was da jetzt noch Besseres kommen soll, um beim nächsten Album etwas vorzulegen, bei dem einem wieder die Kinnlade runter klappt und man sich dieselbe Frage stellen muss. Überbietung allenthalben. Des Eigenen und der Anderen.
„There’s plenty to choose from“, formuliert Åkerfeldt das Problem der Songauswahl als ihn das Publikum mit Wünschen überhäuft. Das älteste Stück, welches die Schweden dabei herausgreifen ist „Credence“ von „My Arms, Your Hearse“ (1998), etwas früher schon im Set spielen sie „Face of Melinda“ von „Still Life“ (1999). Als Leser viktorianischer Romane hat mich die Stimmung, die Opeth hier generiert, immer fasziniert: dieses Düstere, Romantische, etwas Melancholische, das man nicht nur bei den Brontës findet, sondern beispielsweise auch in Wilkie Collins Roman „The Woman in White“, der auf einem Landsitz names „Blackwater Park“ spielt. Heimlich hatte ich ja immer die Vermutung oder Hoffnung gehegt, das gleichnamige Opeth-Album (2001) wäre nach diesem Anwesen benannt, zumal die Musik so passend und deren Cover-Ästhetik allgemein in diese Richtung deutbar ist. Seit heute jedenfalls weiß ich, dass eine deutsche Band Namenspate war. Woher die den Titel haben, muss wohl vorerst unklar bleiben. Wie dem auch sei: Das Wechselspiel großartiger melancholischer Melodien – gespielt durch Keyboard oder Gitarre oder gesungen mit der warmen Stimme Åkerfeldts – und den Death Metal-Passagen mit dementsprechendem Gesang ist ein perfekter Soundtrack zu dieser Literatur.
Auch „Deliverance“ (2002), von dem wir heute „A Fair Judgement“ hören, blieb dieser Überbietungsstrategie treu, während „Damnation“ (2003) dahingehend eine Abweichungsstrategie bevorzugte, dass man erstmals alle Death Metal-Elemente weg ließ. Von diesem Album spielt Opeth „Closure“. Auch hier gilt natürlich: „There’s plenty to choose from“ – man will ja auf keines der Stücke verzichten, aber das eine oder andere hätten sie schon noch zusätzlich spielen können. Und während „Ghost Reveries“ (2005) übersprungen wird, kommt „Watershed“ (2008) mit dem wunderschönen „Porcelain Heart“ und „Hex Omega“ zum Zuge. Auf diesen letzten beiden Alben mischte sich ein interessantes neues Element in die Musik: Während Opeth weiterhin ihr eigenes Schaffen nach dem Platte-raus-Kinn-runter-Prinzip überboten, wichen sie von den Vorgängeralben durch zunehmende 70er-Einflüsse stilistisch ab, ohne dass man sie deshalb als anders denn als progressive Death Metal-Band mit einem ausgesprochenen Hang zu Klargesang und großartigen Melodien hätte einordnen müssen.

Mit der Veröffentlichung von „Heritage“ (2011) ändert sich das schlagartig. Weitgehende Abweichung. Nicht ohne sich selbst zu überbieten, freilich. Jetzt muss man von Opeth – keine ganz unerwartete, aber doch eine überraschend schnelle Entwicklung – als von einer Progressive Rock-Band sprechen, weil typische Metal-Trademarks durch solche des Rock eingetauscht wurden, allem voran die Death-Growls. Diesem Album gilt ein Großteil des Abends: Der Opener ist „Devil’s Orchard“, gefolgt von „I Feel the Dark“, später „Nepenthe“, das Ronny James Dio gewidmete „Slither“ und in der Zugabe „Folklore“. Außerdem gespielt wurde „Throat of Winter“ aus dem Soundtrack für das Computerspiel „God of War II“ (2011), ein Stück, das offensichtlich nicht nur mir bislang unbekannt war.
Wer jetzt aufgepasst hat und das Repertoire kennt, hat bemerkt: Opeth spielen live keinen einzigen Song mit Death Metal-Vocals. Das gab es auch zu „Deliverance“-Zeiten nicht. Ist das ein Statement bezüglich der oben beschriebenen Veränderung der Band? Wir werden sehen.
Für den Moment beachtenswerter ist wohl noch, wie die Stücke vorgetragen werden. Da geht Opeth um einiges weiter als bislang, denn es werden Passagen in Stücke eingefügt, Riffs werden angerissen, doch bevor sie sich richtig entfalten wird noch eine Wiederholung eingeschoben, Strukturen lösen sich in endlosen Melodiefolgen auf – so schön, dass es weh tut. In „Porcelain Heart“ wird ein langes Drum-Solo eingefügt, bei dem Martin Axelrot aber nicht nur einfach drauflos knüppelt, so wie man das sonst bei Metal-Konzerten oft hört: möglichst viel, möglichst schnell. Nein, es gibt eine Struktur aus Motiven und Schlagfolgen, die sich langsam aufbaut, variiert und verändert wird. Das Solo schwillt in Geschwindigkeit und Lautstärke an und ab, wird durchdringender und durchscheinender, donnert und dekonstruiert sich schließlich, bis die Gitarre leise auf die „Porcelain Heart“-Melodie zurück führt. Das passt perfekt, denn die Stücke selbst funktionieren ja ebenso. Immer wieder finden sich völlig transparente Stellen, in welchen nur ein Melodieinstrument oder nur die Stimme zu hören ist, vielleicht gar als Flüstern. Man denke nur an Stücke wie „Nepenthe“. Müßig zu sagen, dass das Ganze spielsicher, perfekt, lässig und sympathisch rüber gebracht wird, als wären die Stücke ein Klacks.
Apropos sympathisch. Vergessen werden darf natürlich nicht, was aus Mikael Åkerfeldt geworden wäre, wenn es Opeth nicht gäbe: Stand-Up-Comedian. Ich bin mir ganz sicher. Bei jedem der Konzerte, die ich bisher besucht habe, hat er sich in irgendwelchen so kurzweiligen wie originellen Witzen ergangen. Ganz locker, sympathisch. YouTube ist voll davon. Und auch die Live-Mitschnitte wie „Roundhouse Tapes“ oder „Lamentations“ machen da keine Ausnahme. Ich sage nur: „My name is Baba Smith“.
Heute hat er es vor allem mit Kassetten. Nach einigem Geplänkel verkündet er, dass er für seine Freundinnen früher immer Kassetten zusammen gestellt habe. Diese hätten sich auch sehr gefreut, nur dass er ihnen ausschließlich völlig obskuren Prog Rock drauf gespielt habe. Trotzdem haben sie sich gefreut, hat er sich doch so viel Arbeit für sie gemacht. Nicht wahr? „I also had a double tape deck, where you could copy cassettes. So when I was done with one girl, I just copied the same cassette for the next girl.” Kein echter Charmeur. Mehr ein Pragmatiker also. Außerdem hat er es heute mit Burt Reynolds. Ich habe keine Vorstellung, wie er darauf gekommen ist, jedenfalls zwingt er das Publikum, mehrmals hintereinander: „We love Burt Reynolds“, zu brüllen, und fügt dann hinzu: „There is nothing gay about Burt Reynolds. I have a mustache, too.“ Irgendjemand ruft: „I love Hello Kitty!“ Das beendet den Spuk fürs erste.
Jeder, mit dem ich nach dem Konzert gesprochen habe, war von dem Auftritt begeistert. Und sehr viele dieser Leute haben, wie ich, schon einige Auftritte von Opeth gesehen, in kleinen und in großen Hallen oder auf Festivals. Opeth schlägt ein hohes Niveau an – man wird da schon verwöhnt –, aber die Band lässt einen dennoch nie hängen. Uns „unterhalten“ zu haben, wie Mikael Åkerfeldt zu Anfang sagte, wird der Sache da wenig gerecht. Besser trifft es ein Besucher, dem an einer leisen Stelle von „Porcelain Heart“ ein: „Zu geil!“, über die Lippen rutscht. So ist es! Dem ist jetzt aber wirklich nichts mehr hinzuzufügen.